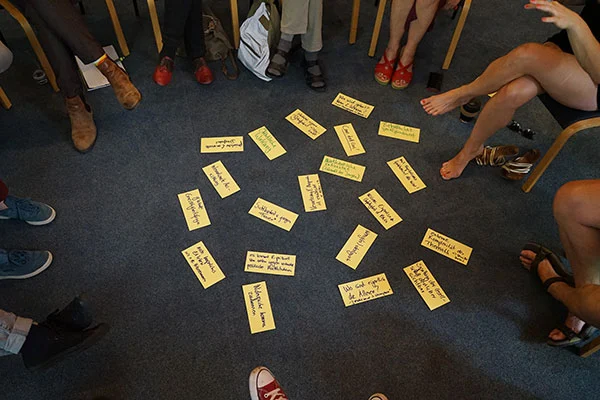Mit progressiver Migrationspolitik gegen die Zeit der Monster
- © Mortaza Shahed/ Unsplash
Kommentar zum Thesenpapier „Zur Lage nach dem Bundestagswahlkampf“ des ISM-Vorstands
Es reicht nicht, Migration in einem progressiven Projekt mitzudenken – Migration muss ins Zentrum einer linken Politik der Zukunft.
Die Zeit drängt. Die Anzeichen verdichten sich: Ohne einen grundlegenden politischen Kurswechsel hin zu einer progressiven Politik steuern wir unweigerlich auf den Abgrund einer neuen Phase der globalen Faschisierung zu. Das Thesenpapier des ISM-Vorstands macht deutlich, wir leben nach dem drastischen Rechtsruck nach der Bundestagswahl hierzulande in „einem anderen Land“ (S.1): Es befindet sich im autoritären Umbau. Das Thesenpapier benennt auch präzise die dramatische Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse für all jene, die sich hier und weltweit gegen die offenen Angriffe im Zeitalter der Monster wehren und Antworten auf die multiplen Krisen suchen. Die verwundbaren Gruppen dieser Gesellschaft, etwa Migrant:innen und Geflüchtete, sind von den Umbrüchen früher betroffen als andere. In einer Zeit, in der die Demokratie selbst auf dem Spiel steht, kann es für demokratische Parteien und progressive Bewegungen kein einfaches "Weiter so" geben. Ein anderes Mosaik ist gefragt, so das ISM (S.2). Allerdings muss dann auch klarer diskutiert werden, wie eine progressive Gesellschaftsstrategie die Realität der Migrationsgesellschaft als Ausgangspunkt nimmt. Es reicht nicht, Migration mitzudenken – Migration muss ins Zentrum einer linken Politik der Zukunft gestellt werden.
Der unerwartete Erfolg der Linkspartei zeigt, dass antifaschistische und migrationspolitische Kämpfe politische Kraft entfalten können. Ihr Durchbruch basierte auf der Verbindung sozialer, antirassistischer und feministischer Perspektiven. Mit Etienne Balibar gesprochen, geht es heute um die „Überlappung der Bewegungen“ (Balibar 2024) – eine neue Form solidarischer Politik, die soziale, ökologische, antirassistische und feministische Kämpfe verbindet. Der Erfolg der Linkspartei ist zugleich ein Erfolg der gesellschaftlichen Linken und eines antifaschistischen Mosaiks, dessen breite Proteste sich an dieser Stelle hoffnungsvoll entzündeten. Daraus ergibt sich ein Auftrag an die Linkspartei, ein Denkzettel für SPD und Grüne, die sich mit eigenen völkerrechtskonformen und nicht völkerrechtswidrigen Maßnahmenplänen der asylpolitischen Restriktionspolitik der Union machtpolitisch annähern wollten, nicht aber dagegenhielten. Daraus ergibt sich aber auch eine Handlungsoption für das kommende Mosaik: einen neuen Resonanzboden für eine Politik solidarischer Transformation vorzubereiten – ja, überhaupt Raum für Hoffnung zu schaffen. Denn der Bundestagswahlkampf hat gezeigt, wie nah wir bereits der anti-demokratischen Destruktion gekommen sind.
Ein anderes Mosaik: solidarisch, transformativ, antifaschistisch
Ein anderes Mosaik im Sinne einer sozial-antifaschistischen Front muss auch über ein Parteienbündnis hinausgehen und angesichts der Kräfteverhältnisse in Deutschland, die sich darin ausdrücken, dass nur ca. 35 Prozent ablehnen, dass eine rechtsradikale Partei zur Wahl steht, auf ein sozial-antifaschistisches Parteienbündnis drängen. Ein anderes Mosaik als antifaschistische Front ist deshalb mehr als ein Parteienbündnis. Es basiert auf der Verteidigung der Menschenrechte gegen autoritäre Einschränkungen und der Solidarisierung sozialer Kämpfe, auf einem antifaschistischen Grundkonsens, der Migration, Feminismus und Klimagerechtigkeit einschließt. Es ringt um kulturelle Hegemonie, in dem der Diskurs über Zugehörigkeit, Solidarität und soziale Rechte entgegen eines Kulturkampfs von rechts verteidigt wird. Ein anderes Mosaik ist auch lokal verwurzelt. Der Aufbau sicherer Städte und solidarischer Kommunen in Zeiten, in denen der Bund nach rechts rückt, sind im Fokus der Verbindung. Und die Arbeit will entgegen der Fragmentierung verbindend sein: Der Aufbau politischer Macht durch Allianzen und gemeinsame Projekte, die sowohl die Verteidigung der Demokratie für alle als auch tiefergehende sozial-ökologisch Transformationen für alle verhandeln, bilden das Herz eines solchen Projekts.
Progressive Migrationspolitik als Prüfstein der Demokratie
Die rechtsautoritär aufgeladenen Forderungen der Union, wie wir sie aus dem Sondierungspapier kennen, haben es zwar nicht in den Koalitionsvertrag geschafft, aber wir sehen, dass die GroKo weiterhin auf „europarechtskonforme Wege“ setzt, um die Möglichkeiten für Schutzsuchende, ihr individuelles Recht auf Asyl wahrzunehmen, faktisch und schnellstmöglich auf Null zu reduzieren, den Sozialabbau voranzutreiben und die „Kriegsbereitschaft“ zu fördern. Reale migrationspolitische und soziale Herausforderungen bleiben dabei unbeantwortet – der autoritäre Umbau schreitet voran. Damit steigt der Druck innerhalb der Krisendynamik weiter an. Mittelfristig auch für die CDU und GroKo. Gleichzeitig reißen migrationsfeindliche Zwischenrufe, wie zuletzt vom Präsidenten des BAMF, auch nach dem Wahlkampf nicht ab. Angesichts der akuten Gefahr, dass heute in der Migrations- und Asylpolitik noch mehr kaputt zu gehen droht und die Ampel schon zu Beginn ihres sinkenden Schiffes ab 2022 zuerst ihre progressiven migrationspolitischen Versprechen über Bord geworfen hat, ist die Gefahr einer fortschreitenden Entsolidarisierung akut. Hier zeigen sich deshalb auch erste Herausforderungen für ein anderes Mosaik. Migrationspolitik wird derzeit in vielen Debatten als Feld defensiver und nicht gewinnbarer Kämpfe markiert, nicht aber als potenzielle Quelle politischer Erneuerung. Hier braucht es mehr: Progressive Migrationspolitik muss in strategischer Perspektive nicht nur autoritäre Politik bekämpfen, sondern diesen Kampf als progressiven Motor demokratischer Transformation denken.
Wer ist die Mutter aller Probleme? Rechtradikalismus oder Anti-Immigration? Die Anti-Immigrations-Ideologie und Praxis wirkt effektiv als „Brückenideologie“ – sie wirkt normalisierend, enthemmt rassistische Diskurse und schafft Anschlussfähigkeit zwischen rechtsextremen Kräften und Teilen der gesellschaftlichen Mitte. Eine fehlende konsequent progressive Migrationspolitik, die progressive Parteien im solidarischen Drittel verteidigen, macht einen Unterschied ums Ganze. Ein ausgehöhltes Asyl- und Migrationsrecht darf kein sicherheits- und innenpolitisches Angebot an verunsicherte Gesellschaftsgruppen werden, die sich nach autoritärer Stabilität sehnen und Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte weiterhin kriminalisieren, entrechten und ausschließen. Genau diesen Weg hat aber die GroKo im Koalitionsvertrag besiegelt. Die SPD hat ihren Preis jeweils nicht in der Migrationspolitik hochgetrieben.
Eine progressive Migrationspolitik steht im Gegensatz zu (militarisierter) Abschottung an den Grenzen und im Inneren, zu Hierarchisierung von Menschenrechten und der Kriminalisierung von Migrant:innen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft wissen längst, wir brauchen Migration und wir sind schon lange eine Migrationsgesellschaft. Übrigens nicht nur in Europa. Eine progressive Migrationspolitik versteht deshalb Migration nicht qua Staatsräson als Problem, sondern als Realität, auf deren Basis gesellschaftliche Arbeit, Gesellschaft und Staat konstruiert werden müssen. Kernelemente einer progressiven Migrationspolitik bleiben weiterhin das Recht auf Schutz, Asyl, Aufenthalt. Menschen bewegen sich und haben ein Recht auf sichere Fluchtwege, menschenwürdige Bleiberechtsperspektiven, die die Basis für Partizipation und Inklusion in allen gesellschaftlichen Feldern bilden. Ankommens- und Aufnahmeprogramme in den Kommunen müssen hierfür als Orte, wo Migration geschieht, massiv gestärkt werden. Zugleich bedarf es gleicher sozialer Rechte als egalitäres Versprechen der Demokratisierung von Bürger:innenschaft für alle. Diese Stoßrichtung muss Kern einer progressiven Migrationspolitik und sozial-ökologischer Transformation bleiben. Die Solidarisierung des Eigentums an öffentlichen Infrastrukturen, an „Gesundheit, Bildung, Wohnen, Verkehr, Energie muss allen frei und gleich zugänglich sein, die hier leben“ (vgl. ISM-Positionspapier 2021). Das sind die elementare Grundlagen der Demokratie in einer Migrationsgesellschaft. Soziale Bürgerrechte müssen dabei vom Staatsbürgerstatus entkoppelt werden. Dazu gehört auch das Recht auf volle politische Partizipation. Angefangen beim kommunalen Wahlrecht. Wenn der Bund nach rechts rückt, gilt es umso mehr, sichere Städte und Bündnisse in den Kommunen zu stärken. Diese progressiven Transformationsprojekte werden auch schon vor Ort eingeübt, verhandelt und gelebt. Eine progressive Migrationspolitik ist auch verbunden mit der globalen Konfliktachse und erkennt die trans- und internationalen Kämpfe um globale Gerechtigkeit und Verantwortung an. Migration ist nicht immer, aber oft Folge von globalen Ungleichheiten, Kriegen und Klimakatastrophen. Es gilt, in einem anderen Mosaik gegen die Zeit der Monster hinter Menschen, Menschenrechten und Kämpfen zu stehen, um den universellen Kampf um Demokratie und Bürgerrechte in Zeiten der Faschisierung zu führen. Und wo auch Platz ist für feministische und queere Kämpfe um Gleichberechtigung.
Das Thesenpapier betont zu Recht, dass es um hegemoniale Kämpfe um die Deutung der Gegenwart und der Zukunft geht. Doch eine solidarische, antifaschistische Hegemonie kann nicht entstehen, wenn Migration als Risikofeld behandelt wird. Sie entsteht nur, wenn eine Zukunftslinke sich darüber verständigt und gemeinsam vereinbart, dass in den zu führenden neuen Kämpfen eine menschenrechtsbasierte Migrationsgesellschaft und die Kämpfe im jüngsten Bewegungszyklus antirassistischer und migrationspolitischer Kämpfe (2013-heute) inhaltlicher Hebel und Erfahrungsquelle für den Modus der kommenden Kämpfe sein kann. Ein Motor der Erneuerung von verbindender Demokratisierung und der Neuzusammensetzung eines gesellschaftlichen Mosaiks. Wo findet diese Verständigung statt? Wer trifft wie die Vereinbarung? Wer ist beteiligt? Welchen neue Politikmodus bedarf es angesichts der gesellschaftspolitischen Krisendynamik? Zur Beantwortung dieser Fragen, bedarf es vor allem Thesenpapiere, Räume und Dialoge, wie sie der ISM-Vorstand zur Verfügung gestellt hat.