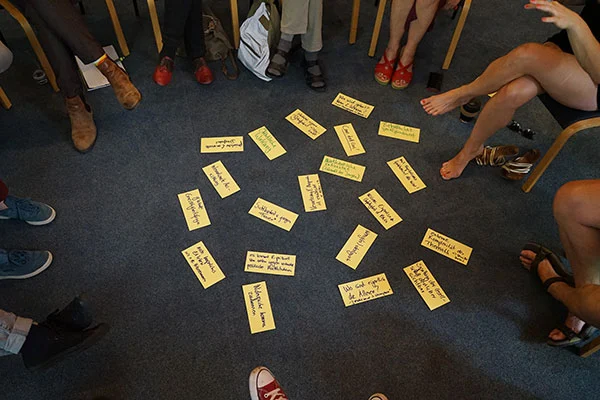- AG Strategieforen des ISM
Zur Lage nach dem Bundestagswahlkampf – Thesen für die gemeinsame Diskussion
Aus der Vorbereitungsgruppe des ISM für das Auftaktforum am 15.3.2025
- © Gerrit WIlcke / Pexels
Jubel über den unerwarteten Erfolg der Linken und Erschütterung über das historisch starke Abschneiden der Rechten sowie das schwache Ergebnis von SPD und Grünen lagen am Wahlabend nahe beieinander. Klar scheint: Nach diesem kurzen, aber harten Wahlkampf findet sich die Mosaiklinke in einer mehrfach und grundlegend veränderten Lage wieder. Sie sollte darauf mit einer strategischen Weiterentwicklung reagieren.
Vorab eine Bemerkung zur Weltlage: Die westliche Weltordnung, wie sie nach dem zweiten Weltkrieg etabliert wurde, ist während des Wahlkampfes zerbrochen. Was für viele überraschend kam, war tatsächlich das Ergebnis einer langen Krise und langsam eskalierender Widersprüche. Donald Trump will dem relativen Bedeutungsverlust der USA im epochalen Übergang zu einer postfossilen und digitalen Form des globalen Kapitalismus mit der skrupellosen Entfesselung ihrer verbliebenen Machtressourcen begegnen. Dafür geht er weltweit ein Zweckbündnis mit autoritären Regimen, wie Putins Russland, ein. Diese Regime sind zwar untereinander vielfach bittere Konkurrenten und ideologische Gegner, treffen sich aber im gemeinsamen Ziel eines autoritären Multipolarismus, in dem nicht menschenrechtliche Normen, internationale (Klima-)Abkommen oder eine kritische Öffentlichkeit, sondern nur noch das Recht des jeweils Stärkeren entscheidet.
Das internationale Staatssystem als Hightech-Version von Game of Thrones – das ist die drohende, reale Dystopie. Ein globaler Wildwest, der sich vom bisherigen Machtkampf der Standorte im globalen Kapitalismus, in dem es immer wieder zu Völkerrechtsbrüchen und Missachtungen der Menschenrechte kam, durch einen wesentlichen Punkt unterscheidet: Diese Normen sollen nun nicht einmal mehr formell gelten und nicht kein Ideal mehr sein, an dem sich die Praxis politischen Handelns wenigstens dem Anspruch nach ausrichten soll. Das ist keine Kleinigkeit, sondern - man muss es gegen die Liberalismusverachtung von links und rechts so klar sagen - ein Unterschied ums Ganze. Es ist ein Freifahrtschein für enthemmte Brutalität. Und das vor dem Hintergrund einer absehbar eskalierenden Klimakrise.
Es verschiebt die Kräfteverhältnisse für all diejenigen, die an den verschiedenen Orten in der Welt gegen Herrschaft, Ungerechtigkeit und die Zerstörung ihrer demokratischen, ökologischen und ökonomischen Lebensbedingungen aufbegehren, fundamental. Auch deswegen sollte es uns interessieren.
-
Ein anderes Land: Für die EU und Deutschland ist diese Entwicklung ein einschneidendes Ereignis. Die Lobby fossiler Energien, neoliberal-libertärer Phantasien und der extremen Rechten wittert auch hier längst Morgenluft. Das Scheitern der Ampel und die vorgezogenen Bundestagswahlen sind Symptome dieser Lage – und die Kräfteverhältnisse hierzulande sind schlechter als erhofft. In Deutschland wären inzwischen bis zu 60 Prozent der Wähler*innen bereit, eine Partei zu wählen, die mit einer offen faschistischen Partei kooperiert, oder dieser direkt ihre Stimmen zu geben. Nur etwa 35 Prozent lehnen das offenbar prinzipiell ab. Das ist die Botschaft des Dammbruchs vom 29. und 31. Januar im Bundestag. Die gewollt herbeigeführte und trotz aller Warnungen und Proteste durchgezogene Abstimmung von Union, FDP und BSW mit der AfD hatte vor allem einen Effekt: eine tiefgreifende Spaltung der bundesdeutschen Parteienlandschaft in eine rechtsoffene Gruppe, die grundsätzlich bereit ist, mit Faschisten gemeinsame Sache zu machen und eine andere, die sich dem konsequent verweigert. Der öffentliche Aufschrei und die massiven Demonstrationen gegen den symbolischen Dammbruch von Friedrich Merz waren ermutigend und haben Schlimmeres vorerst verhindert. Aber Merz hat nichts zurückgenommen. Die Zeit läuft ab, die Normalisierung des Faschismus zu einem regulären Druckmittel politischer Verhandlungen geht in Bund und Ländern kontinuierlich weiter. Die gezielte Attacke der Union auf wichtige Organisationen der demokratischen Zivilgesellschaft ist ein weiterer Beweis dafür. Damit stellt sich die Frage, wie das linke Mosaik wieder eine echte Gestaltungsperspektive öffnen kann, mit neuer Dringlichkeit.
-
Die Krise der liberalen Demokratie ist hausgemacht. Nur eine Demokratie mit einem stabilen sozialen Fundament ist eine stabile Demokratie. Es ist daher fatal, wenn die mediale Debatte vor allem eine Ethnisierung gesellschaftlicher Probleme (wie etwa Gewaltkriminalität) forciert und sich um Abschottung dreht. Davon profitiert die extreme Rechte. Denn der Abschottungsdiskurs lenkt tatsächlich von Wesentlichem ab: Wenig hat der Demokratie und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in der EU langfristig mehr geschadet als die jahrelange Kürzungspolitik und der krasse öffentliche Investitionsstau – bei gleichzeitig explodierenden Vermögen in den Händen weniger Wohlhabender. Dazu kommt die zunehmende Gefahr der Konzentration medialer & digitaler Macht in den Händen von sehr Wenigen, wie etwa Elon Musk.
-
Sozialer Antifaschismus als Bindeglied. Deswegen scheint inzwischen offensichtlich: Wer die Demokratie in Europa verteidigen will, muss auch bereit sein, sich mit Milliardären und Digitalkonzernen anzulegen. Die Ampel war nicht bereit dazu - und wiederholte damit den Fehler von Macron, Fortschritt zu versprechen und dann höchstens halbiert liefern zu wollen. Das Ergebnis war jeweils eine Stärkung der Rechten. Die Abschottung gegen Migration fungiert dabei nicht nur als generelle Metapher für den Schutz gegen die Zumutungen einer aus den Fugen geratenen Welt, sondern ist auch der Türöffner für einen autoritären Umbau der Gesellschaft als Ganzes. Es ist daher kein Wunder, dass sich der öffentliche Widerstand am hauptsächlich symbolischen „Zustrombegrenzungsgesetz“ von Merz entzündet hat.
-
Ein anderes Mosaik I. Derzeit reagieren SPD und Grüne auf den Siegeszug der Rechten weiterhin vor allem mit einer brüchigen Verteidigungslinie für den Rechtsstaat und dem Konzept „Wandel durch Annäherung“ an den rechtsoffenen Mainstream. Sie rücken in wesentlichen Politikfeldern, wie der Einwanderungs- und Asylpolitik, schrittweise immer weiter nach rechts und schaffen es kaum, eigene Themen zu setzen. Der Grund dafür ist nicht zuletzt ihre machtpolitische Fokussierung auf die Union, die nach der liberal-konservativen Merkel-Ära nun unter dem üblichen Verweis auf die „staatsbürgerliche Verantwortung“ relativ geräuschlos sogar auf Friedrich Merz übertragen wird. Solange sich an diesem rot-grünen Stockholmsyndrom und der Angst vor einem Lagerkonflikt nichts ändert, ist ein progressiver Aufbruch auf parteipolitischer Ebene absehbar blockiert.
-
Ein anderes Mosaik II. Profitiert hat davon die Linke, die nach dem quälend langen Abschied von Wagenknecht endlich als glaubwürdiger Gegenpol zum Rechtsruck agierte und Millionen Wähler*innen sowie zehntausende Mitglieder gewinnen konnte. Doch so wichtig Haustürwahlkampf, eine gute Social Media-Mobilisierung und die Standfestigkeit bei sozialen Alltagssorgen (wie Mieten und Preisen) für die Wiederauferstehung der Partei auch waren – es gibt immer noch zentrale Baustellen. Denn die Linke hat als Kraft eines konsequenten und sozialen Antifaschismus gewonnen, und nicht wegen der traditionalistischen Teile ihres Wahlprogramms. Im Gegenteil: Viele Menschen haben trotz und nicht wegen ihrer Außenpolitik die Linke gewählt. Ohne glaubwürdige Konzepte gegen die Bedrohung der EU durch Trump und Putin liefert die Partei den rechten Teilen von SPD und Grünen weiterhin eine verlässliche Ausrede für die weitere Fixierung auf die Union.
-
Hoffnung in der Zivilgesellschaft. Die aktive Zivilgesellschaft, von Gewerkschaften über soziale Bewegungen bis zu Verbänden und Kirchen, hat unterdessen ihre Mobilisierungsfähigkeit gegen rechts unter Beweis gestellt. Allerdings stößt sie, jenseits von Teilbereichen, mit dem Wahlergebnis erneut an die gläserne Decke einer fehlenden, progressiven Gestaltungsperspektive. Damit ist auch das Abklingen der Mobilisierungsdynamik wieder vorprogrammiert.
-
Viele Ansatzpunkte, viele ungelöste Probleme. In der aktuellen Auseinandersetzung um die Schuldenbremse zeigen sich die grundsätzlichen Probleme des linken Mosaiks wie in einem Brennglas. Bei SPD und Grünen sind viele wieder (zu) schnell dabei, der Union mit einer unbegrenzten Ausnahme bei der Schuldenbremse für Aufrüstung und einem begrenzten Sondervermögen für die Infrastruktur vor dem Zwang zu retten, endlich die Investitionsbremse als Ganzes zu reformieren. Sie vertut damit eine historische Chance. Unterdessen wird in Teilen der Linkspartei und der radikalen Linken so getan, als gäbe es keine ernstzunehmende Bedrohung der europäischen Demokratien von außen. Aber die Folie von 1914 ist nicht ausreichend, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verstehen. Der Konflikt um die Schuldenbremse ist dabei mehr als ein Nebenschauplatz. Er wirft grundsätzliche Fragen auf: Was ist der programmatische und strategische Horizont des linken Mosaiks im multipolaren Krisenkapitalismus? Wer gehört heute zu diesem Mosaik und arbeitet in aller Unterschiedlichkeit zusammen? Wo und wie gewinnt dieses Projekt politische Dynamik und Macht? Auf diese Fragen brauchen wir bald Antworten. Denn es geht in den nächsten vier Jahren nun ums Ganze einer demokratischen und sozialen Moderne.
-
Hic Rhodus, Hic Salta. Es ist nie alles möglich. Jede Zeit hat ihre Konflikte und die entsprechenden Entscheidungsmöglichkeiten. Unsere Entscheidungsfrage als Progressive ist heute: Bewältigen wir das Jahrhundertprojekt des nötigen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft im Rahmen von Rechtsstaat und Demokratie, oder verfallen wir auch in der EU verschiedenen Varianten des Autoritarismus? Davon hängt nun alles ab.
-
Für uns ergeben sich daraus zwei sehr konkrete Fragestellungen. Zum einen: Können wir die Demokratie in Konfrontation mit autoritären Regimen wie Putins Russland und Trumps Amerika sowie ihren Proxys hierzulande erfolgreich verteidigen, ohne uns klar auf Seiten einer sozialen, erneuerbaren und demokratischen EU zu verorten? Denn trotz aller autoritären Entwicklungen in und aus den Institutionen der EU finden sich hier immerhin noch demokratische Steuerungskapazitäten und Input-Kanäle, die den nötigen Umbau in den nächsten 20 Jahren noch demokratisch ins Werk setzen könnten – wenn sie entsprechend ausgebaut würden. Zum anderen: Braucht es angesichts der Entwicklung der einzelnen Parteien des progressiven Spektrums und in der aktiven Zivilgesellschaft nun einen neuen Anlauf für ein übergreifendes Bündnis gegen den Rechtsruck? Eines, das einen konsequenten und sozialen Antifaschismus ohne parteipolitische Beschränkungen gesellschaftlich auf eine neue Stufe hebt und das selbst für demokratische Konservative und klassische Liberale anschlussfähig ist? Denn angesichts der offenen Krise unserer Demokratie, des Rechtsdralls der sogenannten Mitte und der unterm Strich zu geringen Ergebnisse des progressiven Spektrums kann es auch im linken Mosaik kein einfaches „Weiter so“ geben.