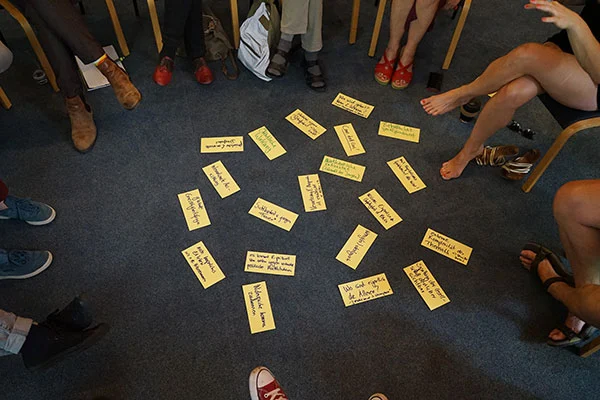Allianz eines sozialen Antifaschismus, kein Kartell der Parteien
- © Falco Masi/ Unsplash
Kommentar zum Thesenpapier „Zur Lage nach dem Bundestagswahlkampf“ des ISM-Vorstands
Die Transformation ist blockiert, die Faschisierung schreitet voran. Das progressive Feld ist noch fähig zur Gegenwehr, doch es fehlt ein positives gemeinsames Projekt.
Man muss keine Cassandra sein um festzustellen: Die Transformation ist blockiert, die Faschisierung schreitet voran, in unzähligen Ländern auf diesem Globus. Die Klimakatastrophe weitet sich nahezu ungebremst aus und die Welt(Un-bzw. Um-)ordnung bringen Handelskriege, verschärfte Konflikte und neue Kriege mit sich.
Auch in der Bundesrepublik zeigt sich: Das progressive Feld wird kleiner. Es ist aber nach wie vor vorhanden und immer noch fähig zur Gegenwehr, periodisch zu Demonstrationen gegen die Normalisierung der radikalen Rechten. Und doch hat es jenseits dessen kein positives Projekt, bleibt zersplittert. Das Mosaik ist zerfallen. Doch wenn wir die Gefahr der Faschisierung ernst nehmen, die weit über die AFD hinaus sich immer stärker in die Gesellschaft hinein verbreitert, braucht es eine Reorganisierung der gesellschaftlichen Linken.
These 1: No Future mit Merz: Die neue Regierung trägt wenig zur Lösung der oben genannten Probleme bei, ist vielmehr Teil des Problems. Sie drängt in vielen Fragen selbst immer weiter nach rechts, in anderen reaktiviert sie spät-neoliberale „Reform“-Ansätze von „Entbürokratisierung“ – also Absenkung von Standards. Neu sind die fast unbegrenzt möglichen Milliarden für die immer weitere Aufrüstung. Ein zweifelhafter Rüstungskeynesianismus, der dennoch massive Kürzungen fordert – vor allem im sozialen Bereich, aber auch bei zahllosen Initiativen im Bereich Demokratieförderung oder des sozialen, politischen und ökologischen Engagements sollen Mittel gekürzt, Ausgaben überprüft werden.
Diese Kombination von Politiken geht an den Ursachen des Aufstiegs der radikalen Rechten vorbei, kopiert diese vielmehr an entscheidenden Punkten wie der Migrationspolitik. Der radikalisierte Konservatismus führt im Ergebnis aber nur dazu, dass die AfD immer stärker wird, wie schon die radikale Rechte in Österreich, Frankreich, den Niederlanden, den USA etc.pp..
Der doppelte Druck von spät-neoliberaler Offensive und Faschisierung erhöht den Druck zur Konvergenz aller verbliebenen progressiven und linken Kräfte. Trotz unguter Ausgangslage verbessert dies die Chancen für neue Ansätze. Die französische Front Populaire hat bei den letzten Parlamentswahlen in Frankreich gezeigt: Erfolge können organisiert werden.
These 2: Für den Erfolg in Frankreich waren jahrelange breite Mobilisierungen der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften grundlegend. Auch in der Bundesrepublik muss dies der Ausgangspunkt sein – keine Parteienkoalition als Neuauflage von R2G (rot-rot-grün), kein „Kartell“ der Parteien, wie Balibar es nennt (vgl. ISM-Papier). Zu heterogen, zu gegensätzlich sind viele Positionen (etwa zur Ukraine oder Palästina); zu sehr sind etwa sozialdemokratische, grüne, linksliberale Kräfte in das Scheitern der grün-kapitalistischen Modernisierung und des progressiven Neoliberalismus verstrickt. Zu lange hat die Linke Vertrauen verspielt durch widersprüchliche Kommunikation, zu lange hielt sie an den selbsternannten „Linkskonservativen“ um Sahra Wagenknecht und deren fragwürdigen Positionen zu Frieden, gegen Emanzipation und Ökologie, für eine rückwärtsgewandte Politik fest. Die Grünen haben bisher keine Konsequenzen aus dem Scheitern der Ampel gezogen, die SPD rückt in einer Koalition mit Merz weiter nach rechts und muss um ihr soziales wie demokratisches Profil bangen – der Weg in Bedeutungslosigkeit kann auch in der Regierung gegangen werden. Nein, in dieser Gegenwart liegt keine Zukunft.
These 3: Es braucht in Anlehnung an Frankreich stattdessen eine „gesellschaftliche Volksfront von unten“. In Frankreich hat die „Front Populaire“ einen guten Klang, erinnert nicht nur an die jüngsten, sondern auch die vergangenen Erfolge der Volksfront gegen den historischen Faschismus der 1930er Jahre, die wesentliche soziale Reformen durchsetzte, die teilweise bis heute gelten. Aber um nicht um den Begriff zu streiten – schon, weil der Volksbegriff von den Nazis offenbar auf ewig besetzt scheint: In der Sache braucht es eine neue Allianz eines sozialen Antifaschismus. Eine Allianz, die den sichtbaren Widerstand organisiert, eine solidarische und demokratische Lebensweise verteidigt und ein überzeugendes Projekt mit gemeinsamen Programm für die Zukunft formuliert. Es muss dabei über die bisherigen Reformversuche hinaus, an die Ursachen der multiplen Krisen und der Faschisierung gehen – in diesem Sinne radikal sein. Das heißt Wiederherstellung und Ausbau einer resilienten sozialen Infrastruktur, den konsequenten sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft und die Rückverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Unumgänglich ist dabei eine Position gegen die Verschwendung von Ressourcen und gegen die Blockade der antizipierten Politiken durch massive Aufrüstung sowie eine kommende Konfrontation mit China. Ebenso unverzichtbar ist die Verteidigung und Weiterentwicklung der von diversen Emanzipationsbewegungen erzielten Fortschritte sowie jener einer postmigrantischen Einwanderungsgesellschaft. Ein verbindendes und klassenorientiertes Mitte-unten-Bündnis, das seine vielfältigen Interessen unter dem Banner eines sozialen Antifaschismus zur Erweiterung einer sozialen und ökologischen Demokratie verknüpft – und ihnen eine Struktur der Organisierung gibt.
These 4: Auf dieser Basis und nur mit dieser Voraussetzung ist mittelfristig auch eine Regierungsoption vorzubereiten. Schon 2026 stehen nicht nur die Wahlen in Sachsen-Anhalt an, die zum Testfeld für eine schwarz-braune, pardon: schwarz-blaue Regierung werden könnten, sondern auch die Wahlen in Berlin. Dort war Die Linke bei den jüngsten Bundestagswahlen zur stärksten Kraft avanciert. Und hier könnte an viele, auch gute Erfahrungen einer rot-rot-grünen Regierung angeknüpft werden. Nicht zuletzt in der Mietenpolitik gab es vielversprechende, immer noch unabgegoltene Ansätze. Berlin könnte zu einem Testfeld für eine größere Perspektive bei kommenden Bundestagswahlen werden, spätestens 2029, und schon um eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern.
Zu diesem Zweck müssen sich die potenziellen parteipolitischen Träger eines solchen Projekts grundlegend erneuern. Die Linke hat sich (nach der Trennung von Wagenknecht & Co) mit dem ungeheuren und unerwarteten Erfolg bei der Bundestagswahl und einer nahezu Verdopplung ihrer Mitgliederzahlen in eine neue Partei verwandelt. Sie muss nun tragfähige Strukturen aufbauen, programmatische Widersprüche auflösen und Leerstellen füllen (von einer erneuerten friedenspolitischen Position bis hin zu konsistenten sozial-ökologischen und ökonomischen Standpunkten). Die Grünen müssen die Fehler ihres Wirkens während der Ampelregierung aufarbeiten und zu einem wirklich linken Programm zurückkehren, in der Opposition Glaubwürdigkeit zurückerlangen. Noch ist davon wenig zu spüren. Es braucht sicher Zeit, aber die Zeit drängt. Noch schwieriger ist es bei der SPD. Die Linke in der Partei ist verstummt, muss sich neu orientieren. Wie eine Partei in der Regierung mit einem radikalisierten Konservatismus eine Erneuerung der Sozialdemokratie bewerkstelligen soll – dafür fehlt mir bislang die Vorstellungskraft. Insofern kann eine mittelfristig notwendige Regierungsoption nicht der Ausgangspunkt sein. Aber hoffentlich ein späterer Durchgangspunkt zur Durchsetzung eines gesellschaftlich vorbereiteten und getragenen Projekts.