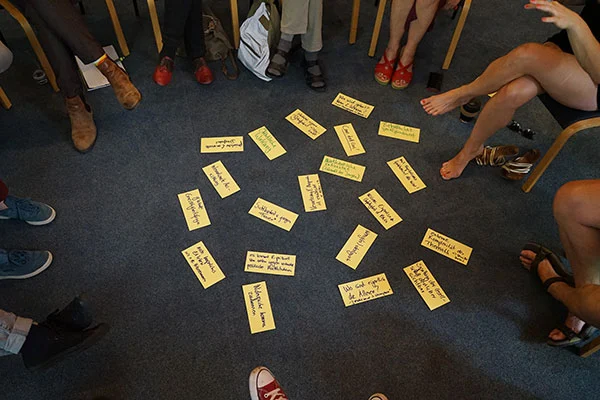Parteien: Notwendig ja, hinreichend auf keinen Fall
- © Caroline Ommer/ Unsplash
Kommentar zum Thesenpapier „Zur Lage nach dem Bundestagswahlkampf“ des ISM-Vorstands
Die beste Analyse des Konformismus und fehlender politischer Ambitionen, die uns einfällt, ist ein halbwitziger Spruch: »Viel Spaß mit dem Wahlergebnis.«
(César Rendueles: »Gegen die Chancengleichheit«)
An der Frage, ob Parteien überhaupt noch adressiert werden können, wenn es um die großen Fragen der Gegenwart geht, kann man sich die Zähne ausbeißen. Es scheint, dass noch jede Partei – egal, wie ihr Gründungsgedanke einst lautete – ab einem bestimmten Punkt ihre Aufgabe nicht mehr darin sieht, eine politische Agenda durchzusetzen, die einen angemessenen Entwurf enthält, dem planetaren Paradigma gerecht zu werden und intergenerationelle Gerechtigkeit zum Ausgangs- und Zielpunkt ihres Handelns zu machen.
Das als Vorwurf zu formulieren, ist vermutlich falsch. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten können Parteien Wahlen gewinnen, Ämter und Mandate bekommen und verteidigen, Interessen bündeln und vertreten, die Stabilität der parlamentarischen Demokratie garantieren, die zugleich eine simulative Demokratie ist (Ingolfur Blühdorn). Der Art und Weise, wie sich Parteien um Macht bemühen müssen, um Handlungsspielräume zu bekommen, ist jedoch die Trennung von Repräsentierenden und Repräsentierten immanent. Alle ehrenwerten Versuche hierzulande, dem zu entgehen oder dies zumindest abzumildern, waren vergeblich. Rotation (Grüne), offene Listen (PDS), konsequente und somit in weiten Teilen chaotische Basisdemokratie (Piraten): Die Basisdemokratie ist vorerst komplett gescheitert, die anderen Versuche wurden entweder als kontraproduktiv auf dem Weg zur Macht und für den Machterhalt angesehen oder als zu aufwendig und anstrengend, letztlich nicht durchhaltbar betrachtet.
Politische Repräsentationsmechanismen unterliegen dem organischen Verfall. Die Parlamentarische Demokratie, der es hierzulande an einer wesentlichen Grundvoraussetzung für Fort-Schritt fehlt – an direkter Demokratie und der Fähigkeit zur Deliberation –, bildet die existenziellen Bedrohungen der Gegenwart nicht mehr ab. Und nun sind wir an einem Punkt, an dem wir uns fragen müssen, ob schockweise eingeführte Mechanismen direkter Demokratie nicht zum Gegenteil dessen führten, was beabsichtigt oder erwünscht war. Zwei Drittel der Menschen hierzulande sind der Meinung, die Bundesrepublik möge weniger Geflüchtete aufnehmen. DEN Volksentscheid kann man nicht wollen.
Wir verfügen über keine Erfahrung mit deliberativen Mechanismen kollaborativen Arbeitens an einem Gesellschaftsprojekt. Rousseau sah in der Demagogie charismatischer Führer und in der Neigung zum Konformismus große Gefahren für die Demokratie. Der Konformismus scheint das größere Problem, denn Charisma lässt sich kaum unterstellen, schon gar nicht einer Partei. Der Konformismus der Gegenwart manifestiert sich in der Annäherung (Anbiederung) einstiger Mitte-Parteien an rechte Demagogen und in einem politischen Tribalismus, der das ökologische Paradigma ignoriert. Das überrascht bei CDU, CSU, FDP oder ganz rechts nicht. Dramatisch ist, dass die Ignoranz auch da verortet werden muss, wo bislang der Möglichkeitsraum gesehen wurde, einen ökologisch-sozialen Wandel auf parlamentarischen Ebenen zur Agenda zu erheben. Im jüngsten Bundestagswahlkampf spielte das Klima keine Rolle.
Auch wenn immer wieder in den Raum gestellt und behauptet wird, ein „Weiter so“ sei keine Option, gibt es viele Anzeichen dafür, dass Weiter so! „das Prioritätsprojekt ist, das fortgeschritten moderne Gesellschaften mit aller Entschiedenheit verfolgen“ (Blühdorn, „Unhaltbarkeit“, 2024).
Parteien sind nicht (mehr) fähig, generativ zu handeln. Das war insofern einmal anders, als dass – egal welcher Couleur eine Partei war – sie stets ein Wachstums- und Wohlstandsversprechen im Gepäck haben konnte. Und zwar völlig unabhängig davon, ob dieses Wohlstandsversprechen für eine Oberschicht, eine Mittelschicht, die sozial Abgehängten oder für alle galt. Jedes Versprechen basierte darauf, dass es Wachstum geben würde und aus diesem Wachstum Wohlstand erwüchse. Selbst wenn die Verteilung der Wachstumsgewinne höchst ungerecht (FDP oder CDU) nach oben erfolgen sollte, ging damit das Versprechen einher, dass für alle etwas abfallen und sich in mehr Konsum niederschlagen würde. Dass die warenförmige Welt für jede und jeden ein paar Segnungen vorhält. Generatives Handeln war insofern ein leichtes Spiel, bedeutete es doch, schlicht und einfach zu behaupten, dass es den Kindern der jetzigen Wähler:innen einmal besser gehen wird. Und so ist es ja im globalen reichen Norden auch lange gekommen. Auf Kosten der anderen, zu Ungunsten des Planeten und schon damals das Paradigma endlicher Ressourcen ignorierend.
Nun stehen Parteien, die den Rahmen ihrer Möglichkeiten zugunsten einer gebotenen Transformation erweitern oder gar sprengen wollten, vor der Aufgabe, zu vermitteln, dass unser Verständnis von Wohlstand und Lebensqualität entkoppelt werden müsste von ökonomischem Wachstum, Fossilismus und Übernutzung aller irdischen Ressourcen (Sonne ist genug). Diesen Diskurs hat noch keine Partei gewagt, zu führen. Und führte sie ihn, wäre die Strafe ihr Untergang.
Über einen neuen Wohlstandsbegriff denken Wirtschaftsethiker:innen der katholischen und evangelischen Akademien, Plurale Ökonom:innen, Klimaaktivist:innen, Wissenschaftler:innen und andere außerhalb von Parteien nach. Sie eint, dass ihnen nicht zugehört wird, auch wenn sie hin und wieder in Expertenkommissionen berufen oder auf Podien geladen werden. Europa ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent, die Wissenschaften und deren Institutionen verweisen zunehmend müde und desillusioniert darauf, dass genügend Daten auf dem Tisch liegen, um die sich daraus ergebende Dringlichkeit in Handeln umzumünzen. Parteien wiederum nehmen zur Kenntnis, dass nur noch rund 40 Prozent der Bevölkerung der Meinung sind, Deutschland müsse mehr für den Klimaschutz tun (vor vier Jahren waren es noch rund 70 Prozent).
Unser politisches System basiert darauf – und die Bevölkerungen der Vergangenheit und Gegenwart sind so konditioniert –, dass bei Wahlen keine Partei aus dem Topf „Sonstige“ rauskommt, deren Versprechen lautet, einen Plan, eine Idee für eine ANGEMESSENE politische Reaktion auf die weltumspannende biophysikalische Bedrohung und Existenzkrise zu haben. Ein solcher Plan bräche in den sogenannten Wohlstandsgesellschaften mit allem, was der überwiegende Teil der Menschen bislang zur Grundlage einer Wahlentscheidung gemacht hat: Es muss besser werden! Und besser ist von Parteien, über die wir hier reden und nachdenken, bislang immer mit MEHR beschrieben worden. Ein MEHR jenseits von Wachstum auf Pump, Extraktivismus und Übernutzung aller planetaren Ressourcen ist bislang nicht versucht worden, zu beschreiben, geschweige denn, in Wahlprogramme zu fassen. Auch keine der drei Parteien, rot und rot und grün, kann etwas Entsprechendes vorweisen. In Abstufungen natürlich, denn trotz aller Enttäuschungen haben die Grünen sicher noch einen Vorsprung und vor allem eine Provenienz, die auf Expertise und guten Willen verweist. Wenn sie das durchblicken lassen, werden sie allerdings übel abgestraft.
Parteien stellen gegenwärtig (ja, das war mal anders, vor langer Zeit) nur Fragen, deren Antworten sie kennen oder selbst formuliert haben. Das reicht nicht mehr für Problemlösung, aber natürlich noch immer für Wahlerfolge, so brüchig sie auch sein mögen.
Die Parteiendemokratie selbst kann nur punktuell weiterentwickelt werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass Parteien NICHT der Hort des radikalen Wandels sind. Sie sind aufs Nationale beschränkt und immer geradezu gezwungen, ein hohes Maß an Opportunismus vorzuweisen, der es ihnen ermöglicht, gesellschaftlichen Entwicklungen (vor allem Stimmungen) zu folgen. Der sie allerdings nicht befähigt, notwendige gesellschaftliche Entwicklungen voranzubringen, geschweige denn, voranzugehen.
Trotzdem birgt dieser Opportunismus auch eine Chance: Wenn es so ist, dass nicht Menschen und Menschengruppen Parteien folgen, sondern Parteien vermeintlichen oder wirklichen Mehrheiten (Zielgruppen, Wähler:innenpotenzialen) zu Munde agieren, hieße das ja auch, dass sich Parteien bewegen und ändern lassen. Und daraus ergibt sich die Frage, ob es ein gesellschaftliches Fundament gibt, das dafür ausreichte, daraus eine progressive Entwicklung wachsen zu lassen. Wer läuft wem hinterher und wer treibt wen in welche Richtung vor sich her? Wer könnte Transformation erzwingen auch dann, wenn die, die es im bestehenden System in Recht und Gesetz und Durchführungsbestimmungen gießen müssen, zu dieser Transformation als Beschlusslage nicht in fähig sind?
Gibt es gesellschaftliche Akteur:innen, die nicht nur fähig sind, miteinander zu kooperieren, sondern auch in der Lage, einen Grundkonsens, eine Willensbekundung zu formulieren, die den großen Krisen der Gegenwart gerecht wird?
Da dies eine offene Frage ist, scheint schon mal eine Denkblockade gesprengt: Nämlich die, dass Parteien die ersten Adressatinnen sein sollten, wenn ein gesellschaftlicher Wandel im Sinne eines solidarischen, global denkenden, ökologisch und sozial verantwortungsbewusst handelnden Projektes erkämpft werden will. Sie sind notwendig, aber nicht hinreichend.