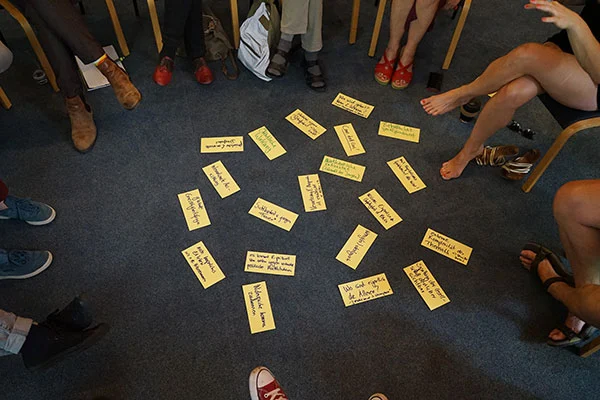- Samuel Decker
Projekt 2029? Die Linke und die Macht
Über progressive Ökosysteme und das Fehlen einer Durchsetzungsperspektive
„Die Krise besteht gerade darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann: In diesem Interregnum treten die vielfältigsten morbiden Erscheinungen auf“ – seit mindestens 15 Jahren vergeht kaum eine linke Diskussion zur Lage der Welt mit Verweis auf dieses Zitat von Antonio Gramsci. Es soll helfen zu verstehen, warum sich ein progressiver Paradigmenwechsel nach Jahrzehnten des Neoliberalismus so schwertut. Das Alte, so die Lesart, vermag zwar keine Legitimität mehr zu generieren, ist aber noch mächtig genug, jede wirkliche Alternative zu verhindern. Diese Diagnose einer „blockierten Transformation“ suggeriert das Bild eines Engpasses, in dem sich aufgestautes Veränderungspotenzial nicht entladen kann und uneingelöst bleibt.
Während Gramsci mit seiner Analyse mutmaßlich gar nicht auf den Faschismus anspielte, sondern auf innerlinke Angelegenheiten, erschwert sie knapp 100 Jahre nach ihrem Entstehen einen ungeschönten Blick auf die realen Veränderungsprozesse, die sich vor unseren Augen abspielen. Seit den 1980er Jahren entfaltet sich kontinuierlich ein multipolarer Kapitalismus mit China als neuem Gravitationszentrum. Die globale Erwärmung und ihre Folgen schreiten seit den 1950er Jahren ebenso ungebrochen voran. „Das Neue“ – ein post-amerikanisches Zeitalter, das die hegemoniale Ordnung des Westens ablöst und im Kontext des eskalierenden Klimawandels und systemischer Knappheiten von geopolitischen und nationalistischen Verteilungskämpfen bestimmt ist – bildet sich fortlaufend heraus. Beim Übergang von der einen zur anderen kapitalistischen Weltordnung lässt sich zwar durchaus von einem Interregnum sprechen. Doch davon, dass „das Neue“ noch nicht geboren wäre, kann keine Rede sein.
Die Lücke der Linken: reale Wirtschaftspolitik
Im Kontext erstarkender rechtsextremer Kräfte verschiebt sich der Fokus in linken Debatten zunehmend auf den zweiten Teil des Gramsci-Zitats, das häufig (möglicherweise nach einer sehr freien Übersetzung von Slavoj Žižek) als „Es ist die Zeit der Monster“ wiedergegeben wird. Der Gedanke dahinter ist: Ein „echter“ Paradigmenwechsel bleibt aus, also werden wir im Interregnum von Trump, Weidel & Co. heimgesucht. Doch in der derzeitigen Transformation des Kapitalismus erweist sich die zeitgenössische extreme Rechte keineswegs als bloßes pathologisches Symptom oder temporäre Perversion, wie die Chiffre von der „Zeit der Monster“ nahezulegen scheint. Sie ist vielmehr strukturelles Merkmal und integraler Bestandteil der entstehenden neuen Ordnung. Ihr Aufstieg ist die politische Reaktion auf den relativen Abstieg des Westens als globales Akkumulationszentrum und den hieraus und aus den ökologischen Verwerfungen resultierenden Verunsicherungen und Verteilungskämpfen.
Diese materielle Basis des neuen Faschismus – seine Verwurzelung in den (kommenden) sozioökonomischen Verwerfungen – wird in der öffentlichen Debatte oft übersehen und durch kulturalistische Erklärungsmuster verdeckt. Die Rechte bietet materielle Lösungen für den neuen Verteilungskonflikt an oder vermag diese zumindest zu suggerieren, auch wenn (bzw., gerade weil) sie den Verteilungskonflikt primär nationalistisch bearbeitet. Zugleich entwickelt sich der Faschismus nicht urwüchsig aus der gesellschaftlichen Basis (gewissermaßen „von unten“), sondern im Zusammenspiel mit alternativen Herrschaftsprojekten (und damit verbundenen Kapitalstrategien) „von oben“.
Auf das Erstarken der Rechten als systemische Entwicklung innerhalb des Kapitalismus reagierte die Linke in vielen Ländern ab Mitte der 2010er Jahre mit einem „Labour Turn“ – dem Versuch, sich aus der metropolitanen Blase zu lösen und „abgehängte“ Milieus bzw. „die Arbeiter*innen“ zurückzugewinnen. Das bereits 2009 erschienene Buch „Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon wurde in der deutschen Übersetzung im Trump- und Brexit-Jahr 2016 zur sinnbildlichen Analyse der Entfremdung der kulturellen und parteipolitischen Linken von ihrer einstigen Klientel. „Neue Klassenpolitik“ war damals die Antwort. Während diese stark auf das politische Subjekt (das „Wer?“ – Arbeiter*innen bzw. prekär Beschäftigte) und die Methode (das „Wie?“ – Organizing) fokussierte, zielt die jüngere Debatte um einen „sozialen Antifaschismus“ bzw. eine „antifaschistische Wirtschaftspolitik“ stärker auf die Frage des „Was?“ bzw. des politischen Programms.
Die grundlegende Idee, „dem realen sozioökonomischen Abstieg und den Abstiegsängsten vieler Menschen eine Lösung [anzubieten], die ihr Leben besser macht“ (Isabella Weber), ist naheliegend. Dass eine derart elementare Programmatik heute neu konzipiert werden muss, markiert den Umfang des strategischen Terrains, das die Linke in den vergangenen Jahrzehnten hat brachliegen lassen. Reale Wirtschaftspolitik und konkrete makroökonomische Transformationsinstrumente (etwa Preiskontrollen) wurden in der gesellschaftlichen Linken in der Vergangenheit kaum diskutiert, trotz ausufernder Debatten um „sozial-ökologische Transformation“.
Das progressive Machtprojekt
Ich will in diesem Beitrag zusätzliche Aspekte einbringen, die meines Erachtens in der aktuellen Diskussion zu kurz kommen. Neben einer klaren, auf wenige Punkte beschränkten Programmatik, die die Lebensrealität der Mehrheit real verbessern kann, sowie auf diese Mehrheit ausgerichteten Kommunikations- und Organisierungsstrategien bedarf es einer realen, machtpolitischen Durchsetzungsperspektive für linke Politik. Während die extreme Rechte mit dem „Projekt 2025“ selbstbewusst einen Blueprint für eine rechte Machtergreifung und autoritäre Staatsumbildung vorgelegt hat, tut sich die gesellschaftliche Linke mit konkreten Plänen der Eroberung und Ausübung von Macht nach wie vor schwer. Der Slogan „Die Welt zu verändern, ohne die Macht zu übernehmen“ ist noch immer emblematisch für das Verhältnis der Linken zur Macht, die sich nur zu gern in die Rolle der Opposition und des Reagierens auf die Herrschende Politik zurückzieht.
In einem Artikel in The Forge unterscheiden Dan McGrath and Harmony Goldberg in diesem Zusammenhang zwischen dem Aufbau von Gegenmacht (der Fähigkeit, Herrschaft zu blockieren und zu stören) und dem Anspruch auf Gestaltungsmacht (die Fähigkeit, selbst zu herrschen und die gesellschaftlichen Ressourcen umzuverteilen). Zwar sehen die Autor*innen flächendeckendes Organizing als Grundlage jeder linken Strategie an, betonen jedoch zugleich die Entwicklung von Infrastrukturen und Allianzen für die Übernahme und den Ausbau institutioneller Macht als zweiten zentralen Faktor. Neben Kampagnen zu Einzelforderungen und die Mobilisierung spezifischer gesellschaftlicher Nischen fordern sie vom progressiven Spektrum die Entwicklung einer kohärenten Regierungsagenda und den systematischen Aufbau von Mehrheitsmacht.
Dabei geht es nicht um ein naives Verständnis von „Regieren um jeden Preis“, sondern um den systematischen und schrittweisen Aufbau von institutioneller Macht in unterschiedlichen Arenen – diskursiv, elektoral, legislativ, administrativ, juristisch. Die Idee einer „Doppelstrategie“ (Poulantzas), in der auf Staatsapparate abzielende Strategien nur im Kontext gesellschaftlicher Organisierungs- und Mobilisierungsfähigkeit zu denken sind, ist darin enthalten.
Dabei denken die Autor*innen bewusst in einem größeren Ökosystem, das politische Parteien, Akteure aus Staatsapparaten, soziale Bewegungen, organisierte Arbeiter*innenschaft und Zivilgesellschaft mit einschließt. Anstatt des inhärent fragmentarischen und Orientierungslosigkeit stiftenden Begriffs der „Mosaiklinken“ entsteht hier ein Bild einer auf institutionelle Machtübernahme ausgerichteten progressiven Allianz. Das klingt möglicherweise wenig innovativ, doch tatsächlich existiert ein solches progressives Ökosystem, in dem die verschiedenen Strategien und Wirkungsmechanismen der unterschiedlichen Akteure sinnvoll ineinandergreifen, kaum.
Es gibt keine systematische und flächendeckende strategische Planung zwischen Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Medien, Think Tanks und weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen, progressiven Parteien, Insidern aus staatlichen Institutionen und Teilen der Wirtschaft. Es gibt keine gemeinsamen Infrastrukturen zum Aufbau medialer Macht und alternativen Führungs- und Regierungspersonals, keine zusammenführenden programmatischen Prozesse – etwa zur Entwicklung eines „Projekts 2029“. Insbesondere die Koordinierung zwischen „Inside-Track“ (der Arbeit in und mit Institutionen, Parlamenten und Regierungsapparaten) und „Outside-Track“ (Protest, zivilgesellschaftlichem Druck, [medialen] Kampagnen) kommt zu kurz. Während die Rechte diese strategische Doppelung perfektioniert hat, agieren linke Kräfte in diesen Arenen oftmals unkoordiniert, wenn nicht sogar gegeneinander.
Ohne die glaubwürdige Durchsetzungsperspektive eines klar konturierten progressiven Machtprojekts erwarten viele Menschen von der gesellschaftlichen Linken keine Verbesserung, sondern eine Vertiefung der Krise. Die Attraktivität des Katastrophen-Nationalismus speist sich dabei nicht primär aus einer vermeintlichen moralischen Verdorbenheit der Menschen im Neoliberalismus, sondern aus der schlichten Tatsache, dass man ihm zutraut, seine Agenda notfalls auch gegen Widerstände aggressiv durchzusetzen. In der großen ökonomischen, ökologischen und geopolitischen Umwälzung gewinnt die radikal-einfachste Option an Überzeugungskraft – weniger wegen ihrer inhaltlichen Versprechen als vielmehr aufgrund der Aussicht auf entschlossenes Handeln und ein vermeintliches Residuum von Stabilität im Kontext eskalierender Instabilität.
Die Perspektive: demokratische Wirtschaftsplanung
Damit ein progressives Projekt Stabilität versprechen kann, braucht es nicht nur ein kohärentes Programm auf der Basis breiterer gesellschaftlicher Organisierungsstrukturen sowie ein koordiniert agierendes (vor-)politisches Ökosystem. Es braucht auch eine weiterführende Idee des ökonomischen Stabilisierungs- und Steuerungsrahmens, in dem eine „antifaschistische Wirtschaftspolitik“ zu Ende gedacht überhaupt nur funktionieren kann. Auch wenn in der politischen Kommunikation primär die unmittelbaren wirtschaftspolitischen Forderungen eine Rolle spielen, macht sich die größere makroökonomische Leerstelle im Hintergrund bemerkbar. Viele Menschen spüren intuitiv, dass es auf linker Seite schlichtweg keinen Plan dafür gibt, wie alternative Formen der ökonomischen Regulation tatsächlich umgesetzt und international stabilisiert werden können.
Hier setzt die neue Debatte um demokratische Wirtschaftsplanung an, ohne dass sie bislang diese Leerstelle füllen würde. Schon gar nicht taugt sie – ebenso wie die „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ – für sich genommen als Aushängeschild für linkes Campaigning. Doch es ist wichtig, die tiefgreifenden Leerstellen und Probleme linker Transformationsstrategien besser zu verstehen, um nicht einfach nur einen Modebegriff nach dem nächsten – Klassenpolitik, Linkspopulismus, Green New Deal, Anti-Fascist Economics – durchzudiskutieren, während die Welt um uns herum untergeht.
Die fehlende Durchsetzungsperspektive, sowohl politisch-institutionell als auch programmatisch-systemisch, ist eines dieser tiefgreifenden Probleme. Der Aufbau eines funktionierenden (vor)politischen linken Ökosystems, eine programmatische Bündelung („Projekt 2029“) und die Entwicklung einer konkreten makroökonomischen Transformationsperspektive können die nachteiligen Kräfteverhältnissen nicht auf den Kopf stellen. Doch sie verbessern die Ausgangslage, gerade dann, wenn zentristische oder rechte Projekte scheitern. Deindustrialisierung, Zerfall der öffentlichen Infrastruktur, Cost-of-Living-Crisis, Reproduktionskrise, Klimakatastrophe(n), militärische Verschwendung und Zerstörung – sie bereiten den Kontext für progressive Offensiven in der Defensive.
Während die Gegenseite die Interessen von großen Teilen des Kapitals auf ihrer Seite weiß, kann sie keine strukturellen Lösungen für die Poly-Krise anbieten, die im Kern auf einem Mangel gesellschaftlicher Koordination basiert. Während die extreme Rechte tatsächlich inhärentes Merkmal der derzeitigen Entwicklung des Kapitalismus und seiner Krise ist, hat auch die gesellschaftliche Linke ein tiefer liegendes, historisches Potential, das sie in bestimmten Konjunkturen einlösen kann. Damit soll keiner „revolutionären Strategie“, die nur auf den gesellschaftlichen Bruch wartet, das Wort geredet werden. Realistischer und erfolgversprechender sind „symbiotische Strategien“ (Erik O. Wright) in Kombination mit „strategischer Geduld“ – also das langfristig ausgerichtete Erkämpfen von Elementen eines gesellschaftlichen Planungssystems im Bestehenden durch Preiskontrollen, Industriepolitik und Vergesellschaftung von Sektoren, Leitunternehmen und Investitionen.1
*Samuel Decker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Netzwerk Plurale Ökonomik.
1 Aus einem Vortrag von Christoph Sorg am 29.11.2025