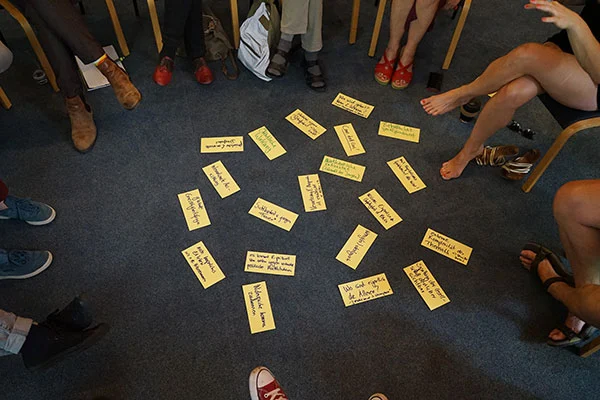Überlegungen angesichts der Gefahr faschistischer Regierungsübernahmen
- © BP Miller/ unsplash
Seit sich das ISM vor 15 Jahren gründete, ist einiges passiert: Krisen haben sich verschärft, Mehrheiten verschoben, einige Mitstreitende aus Gründungszeit zogen sich zurück, neue kamen hinzu. Mitstreiter:innen starben und fehlen uns sehr, Kinder wurden geboren.
Mein Beitrag zur Strategie-Debatte im Institut Solidarische Moderne beginnt mit einem Blick zurück auf die ISM-Gründungszeit Ende 2009 und Anfang 2010.
Wie alles begann: Der Gründungsimpuls
Andrea Ypsilantis Versuch, das Land Hessen mit einer progressiven Mehrheit zu regieren, wurde ausgekontert. Hermann Scheer, der viel zu früh verstarb und der uns an so vielen Stellen fehlt, nahm dies zum Anlass, um Menschen aus SPD, Grünen, LINKEN und der Zivilgesellschaft gezielt für eine neue Initiative anzusprechen. Ein Institut sollte gegründet werden, um zukünftige rot-rot-grüne Regierungen besser vorzubereiten. Dabei ging es um mehr als Gespräche zwischen Parteiakteur:innen. Es ging auch um die Initiierung eines Brückenschlags zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Wissenschaft, Kunst, Zivilgesellschaft, Bewegung und Parteien. Es sollte eine Art Gegenmodell zur neoliberalen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft werden. Dabei war klar, dass wir nicht über die Mittel einer von der Wirtschaft geförderte Lobbyorganisation verfügen würden. Sie erhalten Millionen Euro als Spende, aber wir denken an die Millionen Menschen – so formulierten wir damals den Unterschied vom ISM zur INSM.
Es gab viel zu diskutieren, aber in einem waren wir uns schnell einig: beim Namen. Hinter dem Begriff Institut Solidarische Moderne steckte folgende Vorstellung, die Hermann Scheer nicht müde wurde auszuführen:
Die Linke in der Industriemoderne war stark in Verteilungsfragen und Ökonomie; aber schwach in Fragen von Vielfalt, Ökologie, oder Feminismus. Auch in Reaktion auf diese Ausrichtung setzte die neue Linke, die wir institutsintern als ‚Postmoderne‘ etikettierten, einen starken Fokus auf Vielfalt, Antirassismus, Ökologie und Feminismus bzw. Intersektionalität. Allerdings ging dies einher mit einer gewissen Vernachlässigung von ökonomischen Fragen und Verteilungskämpfen. In unterschiedlichen Schattierungen prägt diese Unterscheidung auch noch heute Kontroversen im progressiven Spektrum. Nun könnte man viel Energie und Zeit damit verschwenden, sich jeweils die Schwächen vorzuhalten und die eigenen Stärken hervorzuheben.
Der ISM-Gründungsimpuls bestand jedoch darin, beide Seite zu verbinden, um auf dieser Grundlage in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mehrheitsfähig und populär zu werden. Dass dies nicht unmöglich ist, zeigen einige positive Beispiele: Ob bei Bernie Sanders Kampagnen in den USA, dem Aufschwung linker Parteien in Südeuropa oder bei den jüngsten Erfolgen der LINKEN hierzulande: Stets wurde das Einigende in den Mittelpunkt gestellt, statt gesellschaftliche Problemlagen gegeneinander auszuspielen.
Was dann geschah: Mögliche Mehrheiten nicht genutzt
Zur Wahrheit gehört jedoch auch: SPD, Grüne und Linke haben die Zeiten möglicher Mehrheiten auf Bundesebene seit 2009 nicht genutzt. Von wenigen Einzelpersonen abgesehen gab es kein ernsthaftes Bestreben, gemeinsam etwas durchzusetzen. Jede der Parteien hatte dafür ihre eigenen guten, aber letztlich partei-egoistischen Gründe.
Es formierte sich jedoch auch keine Bewegung, kein zwingendes Fordern aus Gesellschaft, Wissenschaft oder Kunst in diese Richtung. Es gab wenig hörbare Appelle an die kollektive Verantwortung angesichts dessen, was absehbar auf dem Spiel steht (Demokratie, Abwenden des Klimakollaps, Vermeiden der sozialen und ökologischen Kipppunkte), die Mehrheiten für die so notwendige sozial-ökologische Transformation zu nutzen. Zwischenzeitlich scheint es schon weit entfernt in der Vergangenheit zu liegen, aber vor 2021 waren im Bundestag rechnerisch Mehrheiten für RotRotGrün durchaus möglich und denkbar.
Doch die notwendigen Veränderungen blieben aus, von einigen positiven Beispielen wie den Mehrheitsbildungen in Berlin, Bremen und Thüringen abgesehen. Ob sozial-ökologische Regierungs-Mehrheiten im Bund es geschafft hätten, so grundlegend sozial-ökologisch umzusteuern, wie angesichts der drohenden Kipppunkte notwendig ist1, ist eine Frage, die im Spekulativen bleiben muss. Der Versuch umzusteuern, wurde auf jeden Fall im Bund nicht unternommen.
Der Neoliberalismus verschärfte stattdessen die allgemeine soziale Verunsicherung und minderte die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Infrastruktur. Die Folgen von Krisen (wie Pandemien, wachsende Kriegsgefahr, Zunahme von Extremwetterlagen) trugen ebenfalls zur Verbreitung von Verunsicherung und dem Gefühl der Überforderung bei. All das ist keine Entschuldigung dafür, zum Rassisten zu werden, nach unten zu treten oder Faschisten bzw. Rechtspopulisten zu wählen. Tatsache ist aber auch, dass diese Gemengelage den Rechtspopulisten und Faschisten in die Hände spielt, denn sie nutzen die allgemeine Verunsicherung und bieten sich als Instanz an, die einen Ausweg aus dem Schlammassel des anstehenden Jahrhunderts bietet – sei es durch ein Zurück zu alten Zeiten, sei es kurzfristig durch Abladen von negativen Gefühlen und die Abwertung anderer sozialer Gruppen. Das ihre Antworten nichts aber auch gar nichts an den Ursachen der Krisen ändern, ist eine Tatsache. Aber sie mindert leider nicht ihr Erstarken – zumindest noch nicht.
Was auf dem Spiel steht: Zugriff auf Staatsmacht von rechts
Wahlerfolge rechtsextremer, rechtspopulistischer bzw. faschistischer Akteure stehen auf der Tagesordnung. In mehreren Ländern der Welt haben sie bereits Zugriff auf die Staatsgewalt oder stehen kurz davor, d.h. sie erhalten Zugriff auf den Kernbereich des Staates von der Verwaltung über die Justiz und Bildungsinstitutionen bis hin zu Polizei und Militär. In Deutschland gibt es bisher eine Brandmauer, die noch hält, aber zunehmend bröckelt. Wer würde heute noch mit großem Einsatz darauf wetten, dass in Sachsen-Anhalt die CDU standhaft bleibt? Wenn die AfD einmal in einer Landesregierung ist, könnte dies zur Blaupause auch für den Bund werden.
Sind Rechtspopulisten und Rechtsextreme einmal an der Macht, neigen sie nicht gerade zu Zurückhaltung. Im Gegenteil, es ist damit zu rechnen, dass sie die Spielräume nicht nur nutzen, sondern hemmungslos ausweiten. Dies dürfte ihnen auch deshalb leichtfallen, weil bereits vielerorts Räume, die mögliche Orte von Gegenwehr sind, angegriffen werden. Man denke nur an die Kampagnen gegen die Zivilgesellschaft von rechts.
Anders als in der Gründungszeit vom ISM steht damit heute eine neue akute Aufgabe auf der Tagesordnung: die Übernahme von Regierungsmacht durch Rechtspopulisten und Faschisten zu verhindern und ihre diskursive Hegemonie zurückzudrängen. Für diese womöglich historische Aufgabe braucht es all unsere Klugheit. Dafür drei Vorschläge:
1. Solidaritäts-Garantie
Was heute noch selbstverständlich scheint, kann morgen schon in Frage gestellt werden. Insofern ist jede Gruppe, jede Organisation, jeder Raum, in dem man sich der klaren Ablehnung rechter Hetze sicher sein kann, wertvoll. Diese Räume sind zu pflegen und zu verteidigen, denn wir brauchen diese solidarischen Gemeinschaften als Gegengewicht und zur inneren Stärkung. Und wir sollten auf alle Versuche der Spaltung mit einer Solidaritäts-Garantie reagieren. Solidaritäts-Garantie meint das unbedingte Einstehen für diejenigen, die gerade von rechts angegriffen werden.
Allerdings: So wichtig das verlässliche Verurteilen rechtspopulistischer Inhalte ist, so wenig reicht das allein für eine erfolgreiche Abwehr aus. In aller Deutlichkeit: Verurteilen ersetzt nicht das Verstehen ihrer Wirkweise. Wobei Verstehen ausdrücklich nicht meint, sie zu entschuldigen, sondern vielmehr zu studieren, warum rechtspopulistische Deutungsmuster sich so gut verbreiten2 und dies mit dem Ziel, dem entgegenzuwirken.
2. Negative Affekte und Blame-Games
Zu den methodischen Erfolgsrezepten der Rechtspopulisten gehört, dass sie gezielt negative Affekte bewirtschaften und für den Unmut über alles, was nicht funktioniert, Schuldige anbieten. Sie sind Meister im Blame-Game. Viele Progressive mögen negative Affekte nicht, finden es anti-aufklärerisch, diese zu bedienen, wünschen sich, Menschen allein mit positiven Botschaften zu begeistern.
Ganz persönlich teile ich diesen Wunsch: Wie schön wäre es, wenn positive Alternativen wie ein Grundeinkommen als Demokratiepauschale3, solidarische Ökonomie, die Vier-in-Einem-Perspektive4 oder ein wirklicher klimasozialer Green New Deal5 wahlentscheidend wären. Für einige Menschen sind sie das sogar, und ich habe viel Herzblut und Kopf ins Verbreiten solcher Alternativen gesteckt. Aber ich habe auch in einem Vierteljahrhundert Bewegungsarbeit erlebt, dass am Ende ein konstitutives Außen (z.B. Naziaufzüge, die man stoppen will), etwas, das es zu verhindern (z.B. TTIP) oder zu blockieren (z.B. Castortransporte) oder zu enteignen gilt (z.B. Deutsche Wohnen) am Ende auch im progressiven Spektrum die größeren Mobilisierungserfolge verzeichneten. In der Politik geht es auch immer um Gegnerschaft – wer sie geringschätzt, gerät in den hegemonialen Auseinandersetzungen schnell ins Hintertreffen und wird zur Beute von Kampagnen, wie es etwa den Grünen in der Ampel-Regierung regelmäßig widerfahren ist. Diese Gegnerschaften bestehen aus mehr als Kampagnen und Inszenierung, und das unterscheidet sie von der Affektpolitik der Rechten. Denn tatsächlich gibt es mächtige Gegner, die sich den erforderlichen Veränderungen entgegenstellen. Sie zu benennen, ihre Macht zu beschreiben und durchschaubar zu machen und schließlich Fortschritte auch gegen sie durchzusetzen, bleibt zentral. Deshalb brauchen wir unsere eigenen Analysen und Deutungsmuster. Ansonsten sind die Schuldzuweisungen von rechts das einzige Erklärungsangebot, das sich weitererzählt.
Und Hand aufs Herz, wenn man früh morgens im Berufsverkehr in der übervollen S-Bahn steht, der WLAN-Empfang selbst in Berlin mal wieder nicht funktioniert, man erneut keinen Sitzplatz gefunden hat und dann erfährt, dass sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit verzögert, wenn dadurch das Stresslevel steigt, will man dann wirklich nur positive Alternativen hören oder wünscht sich nicht doch insgeheim Schuldige, auf die man sauer sein kann?6
3. Wirkung statt Wunschdenken als Entscheidungskriterium
An den Reaktionen auf das Thema negative Affekte lässt sich auch der Unterschied zwischen Wunschvorstellungen und tatsächlicher Wirkung veranschaulichen.
Eine Vielzahl von Kontroversen innerhalb der progressiven Kreise bewegt sich darum, welcher Schwerpunkt besonders wichtig ist, welche Tonalität, welche Taktik angemessen, welches Argument wirklich gut ist, welche Strategie nun die richtige sei. Meine Beobachtung ist, in dynamischen Zeiten muss jeweils konkret und anlassbezogen entschieden werden. Ein klarer Kompass hilft dabei.
Letztlich ist angesichts der drohenden faschistischen Machtübernahme dabei folgende Leitfragen zentral: Was hilft wirklich, den direkten Zugriff der AfD auf die Staatsgewalt zu verhindern? Was bewirkt, dass rechte Hegemonie und Wahlerfolge nicht weiter steigen? Bei der Beantwortung dieser Fragen sollten nicht unsere Wunschvorstellung, wie etwas wirken sollte, ausschlaggebend sein, sondern die tatsächliche Wirkung sollte Maßstab unserer Entscheidungen sein. Es geht schließlich womöglich um nicht weniger als die Abwehr faschistischer Machtübernahmen. Kurzum, wir werden immer wieder die Wirkung unserer Argumente und Strategien aufs Neue reflektieren müssen.
Wie es nun weiter gehen kann
All die Versäumnisse der vergangenen Jahre, all die nicht genutzten Potenziale möglicher sozial-ökologischer Mehrheiten haben die Herausforderungen (und die damit verbundene Zumutungen) für uns noch größer gemacht: Den Zugriff der Rechten auf den Staatsapparat gilt es schließlich unbedingt zu verhindern – zur Not auch durch Mehrheitsbildungen, die über das hinaus gehen, was einst zaghaft unter RotRotGrün diskutiert wurde.
In Sachsen kam beispielsweise der Landeshaushalt einer CDU-SPD Minderheitsregierung nur durch eine Tolerierung durch die LINKE zustande. Akteure, die bereits die Kooperation zwischen SPD und LINKEN als Zumutung empfanden, sahen sich auf einmal mit Verhandlungen zwischen LINKEN und CDU konfrontiert. Und angesichts der existenziellen Unsicherheiten, die die vorläufige Haushaltsführung auch für all die sozialen Träger und demokratischen Initiativen bedeutet, die auf Zuwendungen angewiesen sind, warben große Teile der Zivilgesellschaft in Sachsen dafür, die haushaltslose Zeit schnell zu beenden.
Der Abwehrkampf gegen den Zugriff der Rechten auf den Staatapparat ist mit einer Veränderungsagenda zu verbinden. Diese inhaltlich zu füllen, kann Gegenstand lustvoller Diskussionen sein, für die es Räume wie das ISM braucht.
Rund 15 Jahre nach Gründung des ISM sind die progressiven Kräfte um einige Illusionen ärmer und um einige wertvolle Erfahrungen reicher. Nutzen wir diese Erfahrungen, um gemeinsam klüger zu werden und wirkungsvoller zu agieren.
Was angesichts all der aktuellen Zumutungen dabei helfen kann, ist das Wissen um die Offenheit der Entwicklung. Ja die Weltgeschichte zeigt uns nicht nur, dass es manchmal sehr schnell sehr schlimm werden kann. Gelegentlich offenbart die Geschichte auch unvorhersehbare Momente, in denen in ungeplanten Konstellationen Möglichkeitsfenster öffnen.
Diese gilt es dann zu nutzen.
------
1 Vorschläge für eine entsprechende Agenda unterbreitete ich u.a. in den Schriften Linke Mehrheiten – eine Einladung, erschienen im Argument Verlag und zusammen mit Johanna Bussemer in dem Buch: Green New Deal als Zukunftspakt – Die Karten neu mischen, erschienen bei Matthes & Seitz.
2 Vertiefend dazu Kolja Möller: Volk und Elite – Eine Gesellschaftstheorie des Populismus. Suhrkamp 2025 und Nils Kumkar: Polarisierung. Suhrkamp 2025.
3 Mehr dazu hier: Grundeinkommen als Demokratiepauschale und sozialökologische Transformation. In: Becker, M.; Reinicke, M.: Anders wachsen. Von der Krise der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft und Ansätzen einer Transformation. oekom, München, 2018,
4 Frigga Haug: Die Vier-in-einem-Perspektive. Politik von Frauen für eine neue Linke. Argument Verlag. 4. Auflage 2022.
5 Weitere Ausführungen dazu haben Johanna Bussemer und ich in dem 2021 im August Verlag erschienen Buch Green New Deal als Zukunftspakt – Die Karten neu mischen festgehalten.
6 Wobei ein gutes Buch dabei zu haben auch die Stimmung heben kann.