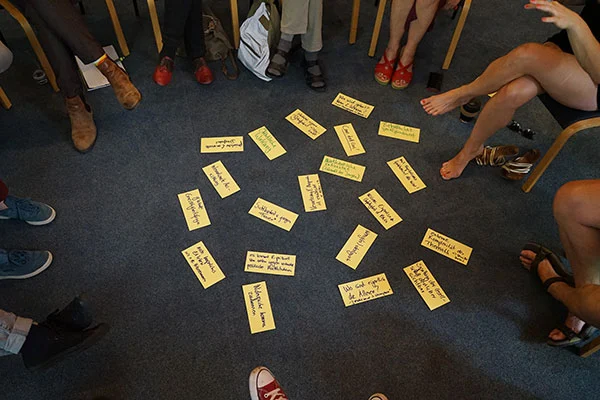- Fabian Kessl
Die Faszination der Disruption
Warum ‚linke Disruptionspolitik‘ ein Widerspruch in sich ist
Die extreme Rechte verspricht den radikalen Bruch und hat damit großen Erfolg. Progressive Kräfte sollten das besser nicht kopieren.
Die gegenwärtigen Verhältnisse schreien einmal mehr nach grundlegender Veränderung. Anlass ist die Vervielfältigung von Krisen und nicht zuletzt die planetarische Dimension der ökologischen Krise, die in den vergangenen Jahren auch im globalen Norden für wachsende Aufmerksamkeit sorgt. Insofern erscheint unsere Gegenwart geprägt von Momenten der Disruption: Das Überschreiten der planetarischen Grenzen zerrüttet die Lebensgrundlagen von Lebewesen und die klimatischen Veränderungen können Gesellschaften ebenso in den Zusammenbruch führen wie Kriege, deren Anzahl im 21. Jahrhundert weltweit wieder zugenommen hat. Disruption meint Zerrüttung und Zusammenbruch, radikale Veränderung also. Unsere Gegenwart ist also offensichtlich eine disruptive, der Eindruck drängt sich angesichts der weltweiten Krisendynamiken auf. Um zu dieser Diagnose zu kommen, muss man auch kein Anhänger der so genannten Kollapsologie-Bewegung werden. Denn im Unterschied zu den Kollapsologie-Annahmen legt die Diagnose fundamentaler Krisen noch nicht die Therapie fest, mit der sie bearbeitet werden sollten.
Angesichts der skizzierten Diagnose der Disruption liegt die Frage nahe, ob auf diese krisengetriebene Gegenwart nicht auch mit einer ‚Politik der Disruption‘ reagiert werden sollte. Wäre dies nicht eine Strategie für progressive Kräfte, den Rechtskonservativen und der extremen Rechten ihr zentrales Konzept aus den Händen zu reißen? Schließlich sind es Milei und Trump, aber auch Meloni und Weidel, die ständig die Disruption beschwören, besonders gerne in der Metaphorik eines ‚Untergangs des Vaterlandes‘. Die Drohung mit der Apokalypse dient autokratischen und extrem-rechten Protagonist:innen dazu, sich als politische Heilsbringer zu inszenieren. Dass sich Donald Trump nach dem Attentatsversuch am 13. Juli 2024 noch deutlicher als zuvor als messianischer Retter feiern ließ, ist in dieser Logik nur folgerichtig. Wäre es nicht ein politischer Coup, dieser Dynamik nun eine progressive Strategie der Disruption entgegenzusetzen? Um diese Frage zu beantworten, ist zuerst zu klären, was sich hinter dem Konzept der Disruption verbirgt.
Rechte Disruptoren
Angesichts der Dominanz von politischen Programmen der Disruption in der extremen Rechten lohnt es zu fragen, ob sich etwa hinter der scheinbar chaotischen try and error-Politik der Trump-Administration eine erkennbare konzeptionelle und strategische Logik der Disruption erkennen lässt. Die ideologische Basis bildet ein markanter Nationalismus, ein massiver patriarchaler Autoritarismus der politischen Führerschaft und ein Rechtspopulismus, der das ‚Volk‘ jeder akademischen und politischen ‚Elite‘ entgegenstellen will. Daneben nutzt Trump, wie auch Milei in Argentinien oder Orbán in Ungarn, den verbreiteten Glauben in die Steuerungsstrategie des politischen Mega-Managers. Das ist kein Zufall, da auch in Managementkontexten immer wieder eine Strategie prominent ist, mit der Märkte ‚neu aufgerollt‘ werden sollen: die Strategie der ‚disruptiven Innovation‘. Jüngeres Beispiel ist der Siegeszug diverser Streamingdienste oder Online-Buchungsportale für Unterkünfte in den vergangenen 25 Jahren. Sie haben höchst erfolgreich kapitalistisch Landnahme betrieben, also Märkte etabliert, die vorher nicht existierten oder bestehende Märkte in bislang unerschlossene Bereiche erweitert. Hierzu brauche es ‚Disruptoren‘, die sich in etablierten Unternehmen nur selten fänden, so die Unterstellung. Dort gebe es vor allem ‚Transformatoren‘, die nur die Verbesserung bestehender Produkte anstreben. Aus diesem Grund würden solche Unternehmen von den ‚disruptiven Innovationen‘ überrollt. Der weltweit bekannteste dieser ‚Disruptoren‘ ist der aktuell reichste Mann der Welt, Elon Musk: Er gilt als Revolutionär der Elektroautoindustrie und sieht sich selbst zudem als Revolutionär der Weltraumindustrie.
So erschließt sich auch eine weitere Parallele: Mit Trump ist ein weiterer Milliardär zum zweiten Mal an die Spitze einer demokratischen Regierung gewählt worden. Bisher war es vor allem ein Kennzeichen von Monarchien, Dynastien und anderen totalitären Regimen, dass die Staatschefs zugleich zu den reichsten Personen des Landes zählten. Kim Jong-un (Nordkorea), Mohammed bin Salman (Saudi-Arabien) und Ferdinand Marcos Jr. (Philippinen) sind sämtlich Milliardäre. Trump sympathisiert mit diesen Autokraten und präsentiert sich ebenfalls als alleiniger Retter der US-Gesellschaft – weniger in monarchistischen und dynastischen Traditionen, sondern eher als Mega-Manager. So wie Musk als Disruptor der Auto- und Weltraumindustrie wirkt, so will Trump der politische Disruptor der USA sein: Nach ihm soll vom politischen System nicht viel übrigbleiben. Es soll eine radikal veränderte USA auferstehen.
Innovation und Regression: Zurück in die Zukunft
Eine solche ‚Politik der Disruption‘ speist sich wie das gleichnamige Managementkonzept aus der Kraft einer Simplifizierung: Mit einem Schlag scheint ein Ausweg aus der Komplexität der Gegenwart ausflaggbar. Wie die Reset-Taste am Computer verspricht die Disruption einen sofortigen Neustart: Das System wird auf die Ausgangseinstellungen zurückgesetzt. Das ist es auch, was das Konzept der Disruption nicht nur auf der extrem Rechten und in rechtskonservativen Kreisen, sondern auch als Managementstrategie so attraktiv erscheinen lässt: „Man muss sich nur trauen“ die disruptive Innovation voranzutreiben und zu platzieren, dann gelingt der ökonomische Erfolg, so die managerielle Suggestion. Die politische Suggestion des Autokraten oder der Autokratin á la Trump speist sich aus einer ähnlichen Überzeugung, überführt diese aber in die Formel: „Wenn endlich einer durchgreift, dann ist erreichbar, was schon verloren erscheint.“ Das zeigt an, dass die manageriellen und die politischen Strategien der Disruption nicht nur Ähnlichkeiten, sondern auch deutliche Unterschiede aufweisen. Die letztere zielt am Ende nicht auf eine ‚disruptive Innovation‘, sondern auf eine ‚disruptive Regression‘.
Isolde Charim wie Steffen Mau haben kürzlich auf das Paradox hingewiesen, das hier aufscheint: Das politische Programm der Disruption adressiert als Programm der extremen Rechten gerade die veränderungsunwilligen Menschen, und macht daher nicht die Innovation, sondern die Regression stark. Das Versprechen der politischen Disruptoren – von Trump über Milei bis Weidel – lautet: Wenn ‚wir‘ (die ‚Einheimischen‘) endlich zu uns selbst finden, brauchen nicht ‚wir‘ uns verändern, sondern ‚nur‘ die anderen (die ‚Fremden‘). Deshalb schicken Trump und seine Adepten die Einwanderungspolizei ICE (Immigration and Customs Enforcement) durch die USA, um die Opfer möglicher Abschiebungen zu identifizieren und zu verhaften. So brutal es klingt: All das dient faktisch nur der Inszenierung eines radikalen politischen Bruchs (und will von den eigenen innen- wie außenpolitischen Misserfolgen ablenken). Das Publikum soll sehen: Nun greift endlich einer durch, um etwas für ‚uns‘ zu tun, um das zu schützen, was ‚uns‘ wichtig ist. Das ist der Affekt, den die autokratischen Disruptoren erzeugen wollen, und der so viele Wähler:innen rechtskonservativer und extrem rechter Parteien verbindet. Dagegen hilft auch der Realitätscheck nicht: Denn es ist klar, dass die Anhänger:innen der Trumpschen Republikaner, ebenso wie die Wähler:innen der AfD oder von Melonis Fratelli d’Italia, mehrheitlich nicht von deren Machtübernahme profitieren. Ganz im Gegenteil: Die Steuergesetzgebung, die die Trump-Administration im Juni 2025 in einer nächtlichen Abstimmung durch das Repräsentantenhaus brachte, sieht Milliardenkürzungen bei Nothilfen und der US-Medicaid, dem Krankenversicherungsprogramm für Menschen mit niedrigem Haushaltseinkommen, vor. Unter Meloni hat sich die Armut vieler Haushalte verschärft und einkommensstarke Haushalte profitieren von Steuervorteilen; das Wahlprogramm der AfD von 2025 hätte, ähnlich nur dem Wahlprogramm der FDP, den bundesdeutschen Topverdienern ebenfalls deutlich am meisten ökonomische Vorteile eingebracht, und den Ärmsten im Vergleich am wenigsten. Doch das Versprechen auf den großen Bruch („MAGA“) erzeugt einen deutlich größeren Affekt und bleibt davon unberührt. Das Versprechen an die ‚Zugehörigen‘ lautet: Von Euch verlangen wir keine Veränderung, nicht in Eurem Lebensstil und nicht in Euren Weltanschauungen. All das wollen wir gewissermaßen ‚unter Naturschutz‘ stellen, so das Versprechen der rechten Autokrat:innen. Aber alles andere wird radikal erneuert.
Disruption von links: ein Sprung aufs Glatteis
Die Faszination der Disruption, des radikalen Bruchs, ist als Revolutionshoffnung schon immer auch Motiv linker Politik. Doch die berechtigten Diagnosen einer Disruption der gegenwärtigen gesellschaftliche Verhältnisse durch multiple Krisen sollten nicht dazu verführen, eine ‚linke Disruptionspolitik‘ zu beschwören. Denn Disruption ist und bleibt eine geschichtslose Konzeption und kann daher keine progressive Position begründen: Sie bricht nicht nur symbolisch mit der Vergangenheit, wie Milei mit seiner Kettensäge anzeigen will, die er im Wahlkampf 2023 als Symbol des Disruptionsversprechens einsetzte und deren Kopie er zwei Jahre später Musk überreichte. Die Disruptionspolitik will von der Vergangenheit nichts mehr wissen.
Doch eine progressive Politik, die sich auf solche Geschichtsvergessenheit einlässt, ist schon auf dem Glatteis des Totalitarismus und der Autokratie angekommen. Nur im Wissen um unsere Eingebundenheit in die Geschichte – des Faschismus wie der Freiheitsbewegungen, der Tyrannei wie dem Ringen um Demokratisierung – können wir über echte Veränderung nachdenken. Das Verführerische einer Politik der Disruption ist ihre Egozentrierung und ihre konsumistische Ausrichtung. Sie will die Zukunft ausschließlich zum eigenen Vorteil gestalten, da ihre Protagonist:innen davon ausgehen, dass ihre Position die einzig richtige ist. Eine Politik der Disruption will außerdem den individuellen Konsum, die Nutzung von Ressourcen, Infrastruktur und Angeboten zum eigenen Vorteil, befördern. Daher verspricht sie die direkt konsumierbare Veränderung. Doch Demokratie ist das Gegenteil von Überlegenheit und individueller Vorteilsnahme. Sie immer auch zu einer selbstkritischen Überprüfung der eigenen Position verpflichtet – zugunsten kollektiver Übereinkünfte und der Verwiesenheit der Menschen aufeinande. Daher ist Veränderung hier nur als Ergebnis der anhaltenden kollektiven Auseinandersetzung denkbar.
Eine Politik der Disruption kann kein progressives Projekt sein, da ihr völlig egal ist, wohin sich die Welt entwickelt. Eine progressive Politik, die immer nur aus der Geschichte heraus entwickelt werden kann, hat dagegen auch eine klare Zukunftsorientierung, der sie sich politisch verpflichtet, etwa in Form eines Universalismus von Gleichheit und Freiheit. Dieses politische Kernprogramm der progressiven Linken ist eben nicht als plötzliche Innovation durchzusetzen. Es steht aufgrund früherer Auseinandersetzungen bereits historisch im Raum und muss von dort aus seiner – bisher unerreichten – Konkretisierung nähergebracht werden. Aufgabe einer progressiven Politik kann nicht die geschichtsvergessene und zukunftslose Disruption sein, sondern nur das Ringen und Streiten um vielfältige „molekulare Veränderungen“ – mit dem Ziel, eine „Matrix neuer Veränderungen“ zu erzeugen, wie es Antonio Gramsci in seinen Gefängnisheften formuliert. Demgegenüber schert sich eine Politik der Disruption nicht um die gemeinsame Geschichte und nicht die um Zukunft aller. Daher kann eine ‚progressive Disruptionspolitik‘ am Ende nur ein Widerspruch in sich bleiben.
Fabian Kessl arbeitet seit 2018 an der Bergischen Universität Wuppertal im Bereich der Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt in der Sozialpädagogik und der Sozialpolitik. Sein Interesse gilt insbesondere der Transformation von Bildung, Erziehung und Sorge im wohlfahrtsstaatlichen Kontext.