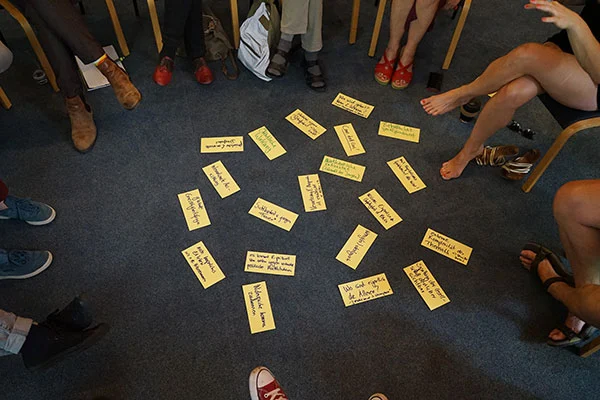- ISM Vorstand
Nach dem Neoliberalismus, vor der Neuen Zeit
Ein ISM-Zwischenruf aus dem Ausnahmezustand
- Martin Sanchez on Unsplash
Gefühlt ununterbrochen reden wir derzeit im Freundeskreis, im politischen Umfeld, im ISM-Vorstand über die aktuelle Krise: bleibend unsicher und im Versuch, Haltung zu gewinnen. Einstweilen haben wir mehr Fragen als Antworten, und zunächst ist das auch gut so. Klar scheint zu diesem Zeitpunkt lediglich eines: Wir haben es mit einer globalen historischen Krise zu tun, deren Ausmaß nicht geleugnet werden kann. Klar scheint auch: Der Ausnahmezustand bestätigt schmerzhaft die gegen das neoliberale System auch von uns seit Jahren schon geleistete Kritik, damit aber auch die noch einmal lauter gewordene Forderung, den Neoliberalismus endlich zu überwinden. Im gelingenden Fall wäre das Durchschreiten der Krise das Durchschreiten seines Endes.
Wahrheit und Gesellschaft
Die Expertise von Virolog*innen und Epidemiolog*innen bestimmt die politischen Entscheidungen, die unseren Alltag aktuell von Tag zu Tag fundamental verändern, manches Mal im Stundentakt. Vertrackt daran ist, dass diese Expertise selbst ein beständiges Suchen ist, weil auch alle gesundheits- und krankheitsbezogenen Expert*innen bis vor wenigen Wochen noch kaum Erfahrung mit dem Virus SARS CoV2 und mit ihm verbundenen Erkrankung Covid-19 hatten. Dabei ist uns bewusst, dass auch die Wissenschaft ein soziales Feld ist, das von mit Kämpfen um Macht, Anerkennung und Wahrheit durchzogen wird. Und trotzdem müssen wir uns in medizinischer Hinsicht schlicht auf das verlassen, was sich als Expert*innenwissen letztendlich durchsetzt.
An sich ist das nichts Neues: Moderne Menschen kennzeichnet die Überzeugung, ihr Handeln nur dann vernünftig ausrichten zu können, wenn sie dazu das notwendige Wissen zur Hand haben. Dabei ging es nie nur um dessen Umsetzung in konkrete, z.B. technische Maßnahmen, sondern immer auch um seine Bewährung und Durchsetzung in sozialen Auseinandersetzungen. Genau da aber begannen und beginnen auch jetzt die viel beschworenen Fragen von Demokratie, Solidarität, um Privilegien und Ausgrenzungen: Wer kann sich in der häuslichen Quarantäne auf großzügiger Fläche und im eigenen Garten einrichten und wer gerät angesichts beengter Wohnverhältnisse in psycho-soziale Nöte oder unter die reale Bedrohung häuslicher Gewalt? Welche Menschen drohen jetzt, wenn sie sich vernünftig verhalten, noch mehr zu vereinsamen? Wer schaut auch einer Ausgangssperre bei laufenden Bezügen entspannt entgegen, genießt unter Umständen sogar die Aussicht auf Entschleunigung im Arbeitsalltag, und wer gerät bereits in diesen Wochen in Existenznot und weiß nicht mehr, wie sie ihre Miete im April zahlen soll? Welche Personen sind gar nicht in der Lage, dem Hashtag #stayathome zu folgen, weil sie ein solches schlicht nicht haben? Wessen Position spielt bei der Entscheidung über weitere Maßnahmen eine Rolle und wer bleibt ungehört? Die deutlich ungleich verteilten Privilegien, Zugänge und Möglichkeiten der Mitbestimmung geraten dieser Tage, trotz aller sozialpolitischen Entscheidungen, noch zu wenig in den Blick: Wir haben es eben keineswegs nur mit einem virologischen und epidemiologischen Problem, sondern mit Auseinandersetzungen zu tun, die gesellschaftliche, kulturelle, psycho-soziale, pädagogische und nicht zuletzt massive ökonomische Voraussetzungen und Folgen haben. Dabei sind Verschwörungstheorien wenig überzeugend, die die Corona-Krise als Strategie der herrschenden Klassen begreifen wollen: Warum sollen diese ein Interesse daran haben, eine Weltwirtschaftskrise auszulösen?
Die Dringlichkeit einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung über den Umgang mit der Pandemie zeigt sich einschneidend an den weltweiten Einschränkungen der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit. Weil sie eine unverzichtbare Voraussetzung von Demokratie ist, geht es hier nicht bloß um die technische Frage, ob der "lockdown" der Gesellschaft von der Infektion bedrohte Gesellschaftsmitglieder tatsächlich schützt. Am Beispiel Italiens zeigt sich bereits, dass dieser "lockdown" konsequent nur mit einer Militarisierung des Alltags durchzusetzen ist: Wie sonst sollen Menschen, die das aus welchen Gründen auch immer wollen, vom Verlassen ihrer Wohnung abgehalten werden? Die moralische Adressierung der Gesellschaft durch die Kanzlerin zeugt davon, dass dieses Dilemma auch den politischen Entscheidungsträger*innen bewusst ist. Dass die gleiche Kanzlerin allerdings auch die Politik einer radikalen Liberalisierung über Jahre massiv mitbefördert hat, die den Menschen jetzt jede Solidarität schwermacht, ja ausgetrieben hat, weil sie stattdessen allein auf Konkurrenz und Eigeninteresse gesetzt hat, darf hier nicht aus den Augen verloren werden.
Solidarität im Ausnahmezustand
Vor diesem Hintergrund stellen sich uns aktuell Fragen wie diese: Was macht die Erfahrung eines sozialen Isolationismus mit Kindern und Jugendlichen? Wie ist mit dem Anstieg häuslicher Gewalt umzugehen, zu dem es unter dem Einschluss in den oft sehr beengten privaten Raum kommen wird, weil Ausweichmöglichkeiten fehlen und psycho-soziale Überforderungssituationen unvermeidlich sein werden? Was wird aus einer Generation, der sich die Aussetzung zentraler Grundrechte und die dazu aufgebrachte Kriegsrhetorik à la Macron langfristig in die politische Sozialisation einschreibt? Wie gehen wir mit den ein-, wenn nicht gänzlich weggebrochenen Haushaltseinkommen der kleinen Selbständigen, mit der Aussetzung der Menschen an der Supermarktkasse oder beim Pizzaservice in die Infektionsgefahr, und wie gehen wir mit der Preisgabe der Geflüchteten in den innerdeutschen Ankerzentren und Sammelunterkünften oder, schlimmer noch, in den Lagern an den europäischen Außengrenzen um, einer Preisgabe in eine Verwahrlosung und Verlassenheit nicht einmal mehr zum bloßen Überleben, sondern direkt zum Tode? Was bedeutet ein virtuell auf die ganze Gesellschaft bezogener Ausnahmezustand, der in Moria 20.000 Menschen in einem Camp zusammenpfercht, das maximal auf 3.000 Personen ausgelegt ist? Ein Ausnahmezustand, der in Wahrheit schon vor Corona da war, der schon vor Corona ein Verbrechen am Menschenrecht war und die von ihm Eingeschlossenen jetzt schutzlos dem Virus ausliefert? Ein Ausnahmezustand also, der schon vor seinem Erlass mit der Macht ausgestattet wurde, nach rassistischen Kriterien zu entscheiden, welche Menschenleben zählen und welche nicht? Noch vor der Antwort auf diese und andere Fragen ist deshalb mit der Kampagne #leavenoonebehind auf der sofortigen Evakuierung der griechischen Lager zu bestehen. Können wir uns darauf nicht einigen, kommen alle weiteren Einigungen zu spät.
Der Verweis auf die Hölle von Moria lenkt den Blick wie von selbst auf gleichermaßen dringliche wie unumgängliche Solidaritäten. Es braucht die Solidarität mit den Menschen in den Lagern in Griechenland – das heißt eine sofortige Evakuierung der Lager und die sofortige Aufnahme hier. Es braucht die Solidarität mit Betroffenen sexualisierter und häuslicher Gewalt, die in diesen Zeiten mehr Möglichkeiten der Online- und Telefonberatung und Zufluchtsorte benötigen. Es braucht die Solidarität mit Menschen ohne festen Wohnsitz. Und es ist Raum für unkonventionelle Ideen und Lösungen. Ein Beispiel wäre die Umnutzung von Hotels, Ferienwohnungen und anderen leerstehenden Gebäuden für wohnungslose oder geflüchtete Menschen.
Solidaritäten sind aber auch überall dort gefragt, wo es um soziale Schutzschirme und deren Ausgestaltung geht. So kämpfen viele sozialen Träger jetzt schon um die Möglichkeit, ihre wichtige Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Frauen, Senior*innen, Geflüchteten und anderen Gruppen fortsetzen zu können, die auf Unterstützung angewiesen sind. In diesen Kontext gehören auch die alltäglich-nachbarschaftlichen Solidaritäten, die sich zum Beispiel zeigen, wenn junge Menschen die Einkäufe älterer Nachbar*innen erledigen, oder wir im Supermarkt, in der Apotheke, auf dem Bürgersteig umsichtiger und rücksichtsvoller gegenüber anderen werden. All‘ das kann und sollte über die Krise Bestand haben und so die Chance wahren, dass im Kleinen bereits ein anderes Miteinander im Großen wächst.
Equal Pay und Care Revolution
Corona befördert schon bekannte Tatsachen deutlicher zu Tage: Am 17. März, dem Equal Pay Day, haben wir nicht nur – so schockierend wie normal – einen Gender-Pay-Gap von 21% konstatiert. Die Pandemie hat uns mehr denn je die Notwendigkeit einer Care Revolution aufgezeigt: Wer ist für die in unserer Gesellschaft und in dieser Krise umso dringender gebrauchte Reproduktions- und Care-Arbeit eigentlich zuständig? So zeigt der Blick auf die (eben nicht nur) momentan dringend benötigten Tätigkeiten im Gesundheits- und Sozialwesen wie im Einzelhandel, dass sie zu über 80% von Frauen geleistet werden, oft von migrantischen Frauen mit geringem Einkommen. Hinzuzurechnen ist, dass Frauen nach wie vor zusätzlich für den größten Anteil der Care- und Reproduktionsarbeit in den eigenen Familien verantwortlich sind. Es sind also, auf den Punkt gebracht, Frauen (mit und ohne Migrationshintergrund, die einen besser, die anderen schlechter bezahlt), die "den Laden am Laufen halten" und dafür sorgen, dass viele andere nicht durchdrehen – gleich, ob im Homeoffice, im Krankenhaus, im Pflegeheim oder im Supermarkt. Hier gilt dasselbe, was weiter oben für Moria galt: dass diese – keinesfalls neuen – Erkenntnisse mehr denn je zu einer notwendigen gesellschaftlichen Transformation beitragen müssen, und das sofort, möglichst weitreichend, und unumkehrbar. Forderungen nach verstetigter Anerkennung und besserer Bezahlung sind hier nur ein allererster Anfang.
Politik – was sonst!
Die radikale Unterbrechung des Produktionsprozesses und der Konsumgewohnheiten zwingt zum Nachdenken. Die verordnete soziale Distanz produziert solidarische Nähe über Balkone, Transparente, in den sozialen Medien. Das erzwungene Flanieren, als eine der noch wenigen Freizeitmöglichkeiten, wird pathetisch gewendet, zum kontemplativen Reflexionsprozess. Will ich wirklich zurück in das Hamsterrad? Und andersherum: Wird es wieder eine Normalität geben können? Doch sind diese zunächst verständlichen Fragen nicht ohne Tücken. Erinnern wir deshalb an eine einfache Wahrheit. Der Kapitalismus war und ist nicht "normal", weder in seiner jüngeren, neoliberalen Form noch in seinen vorangegangenen Formen. Und die Pandemie ist kein exogener Schock, der wie eine Naturgewalt über die Kontinente fegt. Dem Virus ging und geht die Vernichtung der Biodiversität und die Aneignung und Nutzung der Natur voraus, die wie unsere eigenen Leben und Existenzen vollständig dem Verwertungszweck unterworfen wird. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Klimakrise, Naturkatastrophen und den ökonomischen, sozialen und politischen Katastrophen. Es ist die innere Logik kapitalistischer Produktionsweisen, die Krisen erzeugt. Die Kosten von Produktion und Konsumtion werden externalisiert, und sie treffen die Menschen und die Umwelt, immer schon und jetzt besonders. Die richtige Frage lautet deshalb nicht, ob es wieder eine Normalität geben wird, sie lautet stattdessen: Kann oder wird es weitergehen wie bisher, darf und soll es so weitergehen?
Niemand kann heute wissen oder vorhersagen, was wird und wie es wird. Aber die Auseinandersetzung darüber hat bereits begonnen. Wir alle, die meinen, dass es nicht so weitergehen könne, sollten uns nicht täuschen. Die Finanzkrise 2008/9 und die in und nach ihr getroffenen Entscheidungen lehren etwas anderes. Die großen politisch-ökonomischen Erschütterungen und moralischen Empörungswellen waren nach der ersten Stabilisierung schnell vergessen. Stattdessen wurde der Druck der Privatisierung, Deregulierung und Flexibilität noch erhöht. Die geretteten Finanzmärkte setzten ihre ökonomische Logik von neuem durch, mit den bekannten Konsequenzen. Bereits jetzt werden Stimmen aus dem Lager der neoklassischen Ökonomie laut, die den globalen Konsum- und Finanzmarktkapitalismus verteidigen; Die Bundesregierung und der Bundestag haben große Rettungspakete eingeleitet, die Europäische Zentralbank flutet die Finanz-und Kapitalmärkte mit viel billigem Geld. Ist das in Erwartung höherer Arbeitslosigkeit und zur Abmilderung der Krise erst einmal richtig und wichtig, wird dennoch entscheidend sein, wohin das viele Geld fließen soll, bei wem es landet und wofür es eingesetzt wird. Spätestens an dieser Wegscheide beginnt für uns der richtungsweisende Kampf um die sozial-ökologische Transformation und eine solidarische Moderne. An genau dieser Stelle muss die Frage zukünftiger Produktion – was, wozu, wie – auf die Tagesordnung kommen, soll die alte "Normalität" nicht einfach zurückkehren. Man muss keine Prophetin sein, um die Prognose zu wagen, dass es mächtige politische, mediale und ökonomische Akteur*innen gibt, die genau das wollen. Halten wir auch fest, dass wir damit noch nicht alle Gegner*innen einer solidarischen Moderne und einer sozial-ökologischen Transformation genannt haben. Politisch zu streiten wird vielmehr auch mit denen sein, denen es jetzt um die Rekontinentialisierung oder gar Renationalisierung der Welt geht. Obwohl in den Debatten etwa um den Gesundheitssektor zu Recht darauf verwiesen wird, dass etwas falsch läuft, wenn infolge der Jahrzehnte der Globalisierung 80% der Antibiotika aus China importiert werden, herrscht dabei oft ein falscher, mehr noch ein gefährlicher Zungenschlag: anschlussfähig an die seit Jahren nicht zufällig immer stärker gewordene politische Rechte. Die Frage hier ist, ob die Debatte über die Risiken der Globalisierung Chancen bietet für eine solidarische Politik und für eine emanzipatorische Transformation? Es drängt sich geradezu auf, in diesem Kontext nicht nur eine Renaissance einer regionalen Kreislaufwirtschaft vertieft zu denken. Relativ zügig könnten solche Ansätze in der Energieversorgung und der landwirtschaftlichen Produktion implementiert werden. Ebenso könnte die dringende Debatte über eine Daseinsvorsorge in öffentlichem Eigentum eine neue Dynamik gewinnen. Die akute Unumgänglichkeit staatlicher Strukturen dringt mit einer Vehemenz ins gesellschaftliche Bewusstsein, die politisch reflektiert genutzt werden muss: auch hier eben nicht im Sinn einer einfachen Wiederherstellung einstmals "normaler" staatlicher Regulation. Wenn sogar Macron einräumt, dass Gesundheitsvorsorge und Nahrungsketten nicht in private Hände gehören, ist das nach fast 40 Jahren konsequenter Privatisierung und Deregulierung zwar bemerkenswert, aber nicht schon die Antwort auf die Frage, wohin dieses Umdenken führen soll. Das gilt auch dort, wo im Blick auf die wirtschaftliche Rezession Szenarien der Staatsbeteiligung an großen Unternehmen diskutiert werden. Tatsächlich aber führen weder Staatsbeteiligungen, die es bereits in der Finanzkrise 2008 gab, noch weitergehende Verstaatlichungen quasi automatisch zur emanzipatorischen Veränderung der herrschenden Produktionsweise und Produktionsverhältnisse.
Nach dem Neoliberalismus, vor der Neuen Zeit
Gibt es zurzeit auf die Krise keine allgemeingültigen, einfachen Antworten, hat sich doch ein offener Raum für kritische Fragen und neue Ideen geöffnet. Der stählerne Vorhang der neoliberalen Vergesellschaftung ist heruntergekracht. Und jetzt – wohin?
Es ist schön, dass Rewe den Mitarbeiter*innen eine Prämie zahlen will. Der Applaus, die Transparente auf den Balkonen sind moralisch eine Unterstützung für die Arbeiter*innen im Gesundheitswesen. Dass es einen breiten Konsens dafür gibt, dass die Kosten der Krise nicht umstandslos sozialisiert werden dürfen, sondern genau gefragt werden muss, wer wofür aufkommen soll, ist richtig. Doch braucht es jetzt ein zivilgesellschaftliches und politisches Bündnis, das aus diesen ersten Einsichten Konsequenzen zieht und Politik im eminenten Sinn des Wortes auch durchsetzen kann – und sei’s auf mittlere Sicht. Zunächst muss dafür die Zeit des Lockdowns genutzt werden, Strategien zu entwickeln für die anstehenden Deutungskämpfe um die Krise: Wie werden die neuen Staatsschulden interpretiert werden? Wie ist eine Neuauflage von Austeritätspolitiken zu verhindern? Wie können stattdessen endlich die großen Vermögen besteuert und die soziale Infrastruktur ausgebaut werden? Emanzipative Perspektiven haben dann größere Chancen, wenn sie auf den widersprüchlichen Krisenerfahrungen aufbauen: Auf der Relevanz der Care-Tätigkeiten – sowohl in den Pflegeberufen als auch in den eingeschlossenen Familien –, auf den wahrnehmbaren Veränderungen der Naturverhältnisse, dem massiv verringerten Verkehr auf der Straße und in der Luft, auf den entstandenen solidarischen Netzwerken und der gesellschaftlichen Schwarmintelligenz bei der Lösung von Problemen. Wir sind vorgewarnt durch die Verarbeitung der letzten großen Krise, die die neoliberalen Politiken weiter gestärkt statt geschwächt haben. Einer Wiederholung müssen wir uns entgegenstemmen.
In diesem Kontext wird die Bundestagswahl 2021 tatsächlich eine Richtungsentscheidung werden. Sie wird die Bereitschaft für eine sozial-ökologische Transformation zur Wahl stellen. Für den Anfang können dabei wirksame finanzielle Programme im Blick auf Solidarität, Gemeingüter und ein freies und gleiches Gemeinwesen in den Fokus gestellt werden. Es genügt nicht, die Hartz IV-Bürokratie für sechs Monate abzubauen. Die aktuelle Krise wird Arbeitslosigkeit, Insolvenzen und Armut produzieren. Kleine Unternehmen, Freiberufler*innen, Künstler*innen etc. werden erst einmal Jobs und Einkommen verlieren. Es bietet sich geradezu an, das Hartz-IV-Regime jetzt grundlegend zu reformieren. 200 Euro mehr für die Bezieher*innen im SGB II sichern nicht nur die materielle Existenz, sondern tragen zugleich dazu bei, den Konsum anzuregen. Die Diskussion um ein repressionsfreies Grundeinkommen, zumindest für die jetzt Betroffenen, könnte einen tieferen Charakter und eine weiter reichende Dynamik entwickeln. Nicht nur die Gesundheitssysteme sind in der Krise an ihre Grenzen gestoßen. Vielen wurde deutlich, dass die Privatisierungen das Gegenteil von dem erreichten, was sie vorgaben. Machen wir diese Erkenntnis zum Ausgangspunkt der Debatten um die öffentliche Daseinsvorsorge. Die Konflikte um die Wohnungsnot in den Metropolen zeigen, wie dafür Mehrheiten gewonnen werden können. Gesundheit, Bildung, Verkehr, Energie, Teile der Immobilien gehören wieder in die öffentliche Hand. Die Eigentumsfrage kann und muss auf der Tagesordnung bleiben, ohne durch Verstaatlichungen beantwortet werden zu müssen: Vergesellschaftung kann anders und besser funktionieren. Hier könnten die vielen Projekte in solidarischen, genossenschaftlichen, kooperativen, kommunalen u.a. Eigentumsformen, die sich in den Nischen des Kapitalismus unter schwierigen Bedingungen eingerichtet haben, abgesichert und erweitert werden: als Einstiegsprojekte in eine andere politische Ökonomie.
Mittelfristig braucht der Umbau der Wirtschaft hin zu einer sozial-ökologischen Produktion zwei grundlegende Neuorientierungen der Eigentumsordnung und der Gestaltung und Zielsetzung der Produktion. Es genügt nicht, VW oder BMW zu verstaatlichen, damit künftig Bürokrat*innen die Profitrate überwachen. Es muss um die Demokratisierung der Wirtschaft gehen. Wenn der Staat eingreift – und das wird erforderlich sein – brauchen Unternehmen pluralistisch zusammengesetzte Aufsichts-Verwaltungsräte, denen Vertreter*innen aus zivilgesellschaftlichen Bewegungen, Gewerkschaften und Sozialverbänden angehören. Erst dann können Produktion und Distribution neu definiert werden. Es wird kein leichtes Unterfangen, dies in Interessenkonflikten und -konkurrenzen um Absatz und Ressourcen unter nachhaltiger Berechnung der ökologischen Kosten zu tun. Eine rein nationalstaatlich orientierte Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Ökologiestrategie wird dabei nicht tragen, nicht einmal die schon in den ersten Schritten unumgängliche europäische Flankierung und Einbettung: weil eine neue Produktions- und Reproduktionsweise letztlich nur eine globale sein kann. Auch das lehrt uns, wenn wir genau hinsehen und zuhören, die Corona-Krise.
Die gesellschaftliche und politische Linke steht daher vor großen Herausforderungen. Dabei steht sie nicht vor der sowieso völlig halt- und sinnlosen Alternative Klassen-oder Identitätspolitik, weil beide nur im Schritt über sie hinaus zur Grundlage einer gesellschaftlichen, ökonomischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Transformation werden können. Es wird um Politiken gehen, in denen Freiheit die Voraussetzung, Gleichheit der Weg und das allseits realisierte Menschenrecht die Bewährung ist. Die Allgemeinheit dieser Verständigung im Grundsätzlichen schließt die mühselige Verständigung über die nächsten Schritte und ein dabei leitendes Sofortprogramm beginnender sozialökologischer Transformation nicht aus, sondern ausdrücklich ein.